Raum für Aktionen, Menschen und Ideen

Ausstellungen
I am text block. Click edit button to change this text.

Konzerte
I am text block. Click edit button to change this text.

Lesungen
I am text block. Click edit button to change this text.

Kleinkunst
I am text block. Click edit button to change this text.

Seminare
I am text block. Click edit button to change this text.

Galerie
I am text block. Click edit button to change this text.
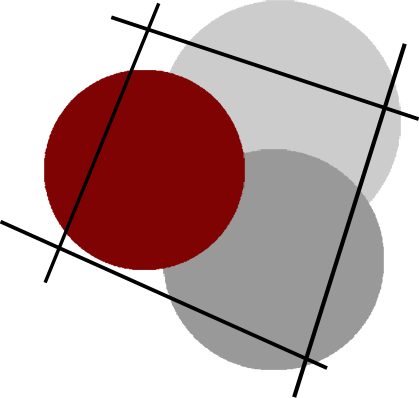
11. September 2021
1. Sulzer Kulturtag
EntdEcken
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
zeigen
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Staunen
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Unter dem Gähnenden Stein
(Sulz 1848–1948)
Kapitel 4: Demokratie
1. Im Auge des Sturms
Montag, 11. November 1918, Sulz.
Im großen Schankraum der Gaststätte „Zum Adler“, seit einigen Tagen Hauptquartier der Sulzer Sozialdemokraten, hingen noch die Vorkriegsplakate an der Wand: Dr. Elswirths Asthma-Zigarette, nur in Apotheken erhältlich und Fischer’s Deutsch-Südwest-Wolle, mit dem Schutztruppler, der dem Löwen das Garn entreißt. Der Wirt, Philipp Tag, hatte bei der Schutztruppe gedient, damals, als er noch kein Sozi gewesen war, und er hatte Probleme damit, seine Vergangenheit zu verleugnen, die ihm hier und heute kein Ansehen verschaffte. Dabei hatten sie doch nur… Tag rief sich zur Ordnung. Ein toller Haufen, dachte er. Solange der Ernst weg ist. Vier Wirte, ein Handwerker und eine Rentnerin. Immerhin die „Sulzer Chronik“ oder wenigstens deren Nummer zwei. Was gibt das für einen Arbeiterrat? „Einziger Tagesordnungspunkt“, sagte der Vorsitzende, Flaschner Simen, „was tun wir in Sulz?“ „Bevor wir hier weitermachen“, sagte der Burgwirt Buzzi, „stelle ich den Antrag, dass wir abwechselnd tagen, nicht immer hier. So gut dein Bier ist, Tag.“ Hiller vom „Wiesental“ und Gustav Keck, derHirschwirt, nickten. Die Tür flog auf, herein stürzte der Jakob Oesterle. „Genossen, die Österreicher wollen uns helfen. Ich hab‘ mit dem Soldatenrat geredet, die schicken eine Kompanie zur Einquartierung.“ Die Österreicher, das war ein Pionierbataillon, für zwei Tage in Oberndorf aufgehalten, alle Offiziere davongejagt, vollständig in Rätehand. „USPD und SPD mal wieder zusammen“, strahlte die Anna Braner, „dass ich das noch erleben darf.“ Der Kasper war schon aufgesprungen und auf dem Weg in die Redaktion.
„Ich rufe auf“, sagte Stadtschultheiß Wilhelm Malmsheimer, „Tagesordnungspunkt drei, Erhöhung der Stromgebühren, und gebe das Wort gleich an…“. Dem Gemeinderat Kienzle zum Hecht platzte der Kragen. „Hier sitzen wir und quatschen und draußen ist Revolution! Ziegler, Frey, sagt doch auch mal was. Wir müssen uns doch was überlegen!“ Malmsheimer stand auf, ging zum Fenster, schaute demonstrativ hinaus. „Ich kann da draußen keine Revolution entdecken“, sagte er trocken. Der Reihe nach sah er seinen Gemeinderäten herausfordernd ins Gesicht. Bankdirektor Vayhinger tuschelte mit dem Färber Krämer, der Bierbrauer Tag jun. streifte die Asche seiner Zigarre ab, der Maurermeister Bertrand guckte in die Luft, Plocher zum Waldhorn und die übrigen Mitglieder der Wirtefraktion schauten teils angestrengt, teils nachdenklich in ihr Bier. „Ich gehe davon aus, dass Sie die Vorlage gelesen haben“, fuhr der Schultes fort. „Wer wünscht das Wort?“ Keiner wünschte das Wort, nein, doch, der unvermeidliche Verwaltungsaktuar Böhm, der die Preiserhöhung voll mittragen wollte, sich aber doch der Befürchtung nicht enthalten konnte, dass in zwei Monaten schon wieder… Rüde unterbrach ihn Malmsheimer. „Spekulationen sind nicht Gegenstand der Abstimmung. Wer ist dafür? Bei fünf Enthaltungen angenommen. Punkt vier, Ausbesserung des Wegs zum Lenglisöschle.“
Soweit man das jetzt übersehen kann, hat sich der Umsturz im Lande in aller Ruhe und Ordnung vollzogen. Es kam nirgends zu Ausschreitungen und Gewalttätigkeiten, schrieb der Redakteur Bosch ans Ende seines Artikels über die Revolution in Berlin und Stuttgart, den Thron-„Verzicht“ des Kaisers und seine Flucht ins holländische Exil. Wie er sie hasste, diese Demokraten, diese Vaterlandsverräter! Aber im Moment durfte man nicht deutlicher werden, niemand wusste, wie die Sache ausgehen würde. Im Stillen gratulierte er sich dazu, all die Jahre den Kasper Braner nicht rausgeschmissen zu haben, obwohl er ein Roter war. Eine Laus in seinem Pelz, aber jetzt nützlich! Niemand konnte ihm vorwerfen, nicht objektiv über die Zeitläufte zu berichten. In Sulz war ja noch gar nix passiert. Alles ruhig. Der Bosch schaute zu den hell erleuchteten Fenstern des Ratssaals hinauf. Der Malmsheimer leitete seine Gemeinderatssitzung, als wäre nichts geschehen. Der Mann hatte Eier aus Stahl. „Na, du Revoluzzer“, sagte er wenigstens für den Augenblick gutgelaunt zum Braner, der gerade zur Tür reinkam, „wann stürmt ihr das Rathaus?“
2. Das richtige Leben im falschen
Dienstag, 12. November 1918, Sulz
Der Stadtschultheiß Malmsheimer bereute nicht viel in seinem Leben, aber das ganze Obergeschoss seines Hauses an die Anna Braner vermietet zu haben, war vielleicht doch ein Fehler gewesen. Dort oben war jetzt ein Seminarraum eingerichtet worden, in dem der ehemalige Gefreite und selbsternannte Studienleiter Josef Bronner als Untermieter eine Zweigstelle der Mannheimer Abendakademie betrieb. Der Raum war über eine Außentreppe zu erreichen, deswegen hatte der Schultes damals auch der Untervermietung zugestimmt. An drei Abenden die Woche unterrichtete jetzt der Bronner Stenographie und Englisch; seine chinesische Landeskunde hatte er bald streichen müssen. Dennoch, Malmsheimer war misstrauisch. Hatte er sich da die Emanzipation ins Haus geholt? Selbst seine Frau und seine Töchter hatten sich die Erlaubnis zur Teilnahme an Kursen ertrotzt. Dass der Bronner sich über Wasser hielt, gar heiraten und Kinder haben konnte, war allerdings nicht den lächerlich niedrigen Kursgebühren zu verdanken, seit dem Hungerwinter 1917 waren auch Kartoffeln akzeptabel. Überleben konnte die „Volkshochschule“, wie sie hochtrabend firmierte, nur durch die Großzügigkeit der Frau Braner.
1914 hatte der Bronner der mit dem allerorten als erlösend empfundenen Kriegsausbruch einsetzenden Dichtungsdiarrhöe in den deutschen Zeitungen etwas entgegensetzen wollen. Damals, erinnerte er sich, brachte jeder Tag, wie er mal in einem Schweizer Blatt gelesen hatte, 50.000 neue „patriotisch-poetische“ Machwerke hervor. Gerhart Hauptmann, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal schmierten volle Kanne mit. Bronner suchte und fand englischsprachige Dichter, die dem modernen Krieg ablehnend gegenüberstanden. Manche wurden nur allzu gerne von der Militärzensur zugelassen. Es dauerte allerdings nicht lange, und die deutsche Euphorie schlug in Entsetzen um. „Kreisch / Peitscht / Das Leben / Vor / Sich / Her / Den keuchen Tod / Die Himmel fetzen. / Blinde schlächtert wildum das Entsetzen“, reimte der Postbeamte August Stramm, kurz bevor er an der Ostfront fiel. Jetzt konnte Bronner den zwiespältigen Sigfried Sassoon „I would gladly stick a bayonet into a German by daylight“ mit Wilfred Owen „Die alte Lüge, dulce et decorum est pro patria mori“ vergleichen oder gar mit dem zutiefst humanistischen Herbert Read „Liedholz shot at me / and I at him.“ Der Deutsche gibt sich gefangen, sie reden: „In broken French we discussed / Beethoven, Nietzsche and the International / He was a professor / living at Spandau / and not too intelligible.“ Read hatte er in Basel getroffen. Eigentlich hätte er ja wieder einrücken müssen. Als nach dem 2.8.1869 und vor dem 2.8.1897 Geborener war er gestellungspflichtig. Aber die Kreiswehrverwaltung hatte ihn nicht einmal für den mobilen württembergischen Landsturm haben wollen.
Die Kreide zerbröselte in der Hand. Schlechte Qualität, wie fast alles am Ende des fünften Kriegsjahres. Kein Schwamm, ein Lappen aus Holzwolle. Schmierte, wischte die Tafel nicht sauber. Weiß Gott, was in der „Kreide“ alles drin ist, dachte der Bronner. Es war schon wieder kalt im Raum. Die Kursteilnehmer hatten nicht genug Holzscheite mitgebracht. Die Stimmung war gedrückt. Sassoon hatte sich erneut jeglicher Deutung entzogen. War er nicht doch zwischen den Zeilen stolz, sich in all dem Elend, das er anprangerte, stoisch zu bewähren? Der Mann, der einen deutschen Graben stürmte, sich dann zwischen die Leichen setzte und in einem Gedichtband las? Sagten mehrheitlich Männer. Die meisten Frauen meinten, das sei Quatsch. Bronner hielt sich heraus, so blieb er die Autorität. Larissa zog im Hinausgehen ihren Mantel über. Heute trug sie den dunkelblauen, sie würde ihn an ihrem Platz hinter dem katholischen Kirchlein erwarten.
3. Eine Kleinstadt hält den Atem an
Mittwoch, 13. November 1918, Sulz
„Das kommt nicht ins Blatt!“, schrie der Redakteur Bosch. Ihm war mulmig zumute. Seit letztem Samstag gab es in Stuttgart eine Provisorische Landesregierung, am Sonntag hatte sich der Oberndorfer, am Montag der Rottweiler Soldatenrat gebildet. Im Oberamt Sulz war noch alles ruhig, sollte man dem Gesindel Flausen in den Kopf setzen? „Das sind doch alles Juden und Bolschewisten!“ Der Braner schwieg. Dann eben morgen, dachte er. Du wirst es schon noch lernen.
In allen Orten des Oberamts blieben die Öfen in den Schankstuben über Mittag an, aber viel Umsatz machten die Wirte nicht. Kein Vergleich zu den Siegesfeiern des ersten Jahres, kein Vergleich auch noch zu den frühen Trauerfeiern. „So eine schöne Leich‘!“ hatten sie im Waldhorn gehabt beim Julius Franz, dem ersten in der langen Reihe, traurig, und doch erbaulich, aber da war der Krieg erst sechs Wochen alt gewesen. Als immer mehr Krüppel zurückkamen, als die Heldennamen nur so prasselten: erschossen, verblutet, vergast, ertrunken oder vermisst, im Lazarett gestorben oder in kleinste Teilchen unauffindbar zerrissen, wurden die Reden kürzer, die Zeremonien hastiger, die Kränze mickriger. Und jetzt dieses Bier: teuer und dünn. Aber vielleicht war das gut, dass man keinen anständigen Rausch davon kriegen konnte. Es gab ja so viel zu besprechen, zu planen, besonders bei denen, die sich ein besseres Leben versprachen. Die Kostgänger des alten Reichs blieben hinter den Gardinen, geschockt, verängstigt. Wie würden die neuen Herren mit ihnen umgehen?
Einer hatte nicht vor, sich dem Geist der neuen Zeit zu beugen. Im Schutze der Dunkelheit machte sich der Herausgeber und Redakteur Johann Bosch auf den Weg ins Malmsheimersche Wohnhaus. Auf der Treppe kam ihm Anna Braner entgegen, sie grüßten einander so kurz es eben anging. Der Schultes führte Bosch in die Küche, wo es warm war, schickte seine Frau fort, kredenzte ein Kirschwasser. Bosch kam gleich zur Sache. Man könne den Umsturz sicher nicht mehr aufhalten, aber abfedern, das ginge doch. Noch seien nicht alle über Nacht zu Demokraten geworden. Jetzt komme es darauf an, ein Netzwerk zu bilden, sich gegenseitig unauffällig zu unterstützen und den Bolschewiki Fallen zu stellen, sie lächerlich zu machen, ihre Herrschaft in Zweifel zu ziehen, sie letztlich zu untergraben. „An wen haben Sie dabei gedacht?“, fragte der Hausherr. Bosch konsultierte sein Notizbuch. „Dr. Hermann und Studienrat Köpf vom Alldeutschen Verband, Wilhelm Böhm…“. Da stöhnte Malmsheimer, sagte aber nichts. „Böhm, jawoll“, sagte der Bosch, „ist der Vorsitzende des Bezirkskriegerverbands, war bei der Vaterlandspartei.“ „Und hat die Kriegsbetstunde geleitet, ich weiß. Aber er ist halt so ein…“. „Wichtig ist“, sagte der Bosch, „dass wir Lehrer und Pfarrer im Auge behalten. Bei unseren Katholiken…“, er nickte vielsagend. „Auf das Oberamt und die Polizei ist Verlass. Dann haben wir Krankenhaus, Verwaltung, Polizei, Schule und Kirche unter Kontrolle. Den Rest erledigt die Zeitung. Meine Kommentare, und ich habe ein paar Leserbriefschreiber zur Hand. Oder welche, die einen ‚Leserbrief‘ unterschreiben.“ „Na dann“, sagte sein Gastgeber, „Prost.“
Der hat gut schwätzen, dachte der Malmsheimer, immer noch unterwältigt, als er die Tür hinter seinem Besucher schloss. Ich bin Beamter, habe meine Anweisungen. Das Oberamt kann ich nicht einschätzen. Der Gunzenhäuser lässt sich nicht in die Karten gucken. Schule und Kirche, so ein Schmarrn! Die Kontrolle will er wohl selbst übernehmen. Mich steuern! Dem Bosch traue ich alles zu. „Elsi, kannst wieder reinkommen. Mach mir’n Tee.“
Der Malmsheimer ist auch angezählt, dachte der Bosch auf der Treppe. Oder hat er seine eigenen Pläne? Ich traue ihm nicht, dem alten Fuchs. Aber das größere Publikum hab‘ ich.
Ihren Tribelhorn Nautilus hatte die Anna heute stehen lassen, der hing noch an der Steckdose. Der Bosch beim Schultes, das hatte etwas zu bedeuten! Die alten Kampfhähne verbünden sich jetzt wohl, dachte sie. Ein Lied fiel ihr ein, das der Jogi ihr… ach, Jogi! Das ist der Wind der Reaktion, summte sie, der dennoch weht, trotz alledem. Und grinste, das ist die Bourgeoisie am Thron, der dennoch steht, trotz alledem. Na wartet! Das hier dreht ihr nicht mehr zurück. Die Genossen in der „Burg“ waren auch nicht sehr beeindruckt. Was können zwei alte Männer schon ausrichten gegen uns? Ab Freitag haben wir Waffen.
4. Biedermänner an die Macht!
Montag, 18. November 1918, Sulz.
Es dauerte dann doch noch fünf Tage, bis die Revolution nach Sulz kam. Am Freitag waren die Österreicher eingerückt, am Samstag und Sonntag waren im ganzen Oberamt die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte wie Pilze aus dem Boden geschossen: Wittershausen, Dornhan, Mühlheim machten den Anfang; der Sulzer Arbeiterrat gründete sich am Sonntag im „Adler“. Das Rathaus war nicht besetzt. Die Revolution musste warten. Man hatte keinen Schlüssel.
Endlich hörte die dumme Pute auf mit Jammern. Als ob die Idee seiner Frau, nicht ins Amt zu gehen, je eine Option gewesen wäre! Malmsheimer war aber doch etwas nervös an diesem Montagmorgen. Erschießen werden sie mich nicht, dachte er auf dem Weg ins Rathaus, aber vielleicht gefangen setzen? Das Gesicht vom Schließer Haberstroh, wenn sie mich einliefern! Das wär’s ja alleine wert. Kommt darauf an, wie viele Sulzer dabei sind. Aber ich werd‘ bluffen, meine Herren! Glauben Sie bloß nicht, dass ich mich kampflos ergebe.
Die Tür zum Dienstzimmer stand offen, der Genosse Kuhn, Vorsitzender des Arbeiterrats, im schwarzen Sonntagsanzug, klopfte an den Türrahmen. Braner, Mutschler, Haag und Simen drängten nach. In der Tür blieben die zwei Pioniere stehen, Gewehre lässig abgestellt. Malmsheimer schrieb im Gemeinderatsprotokollbuch, blickte nicht einmal auf. Kasper räusperte sich, der Schultes tat überrascht: „Herr Braner, Sie hier? In welcher Eigenschaft, wenn ich fragen darf? Womit kann ich Ihnen dienen?“ Kuhn brachte etwas unbeholfen vor, der Arbeiterrat habe jetzt die Macht in der Stadt übernommen, er, Malmsheimer, sei abgesetzt. „Und wie haben Sie sich das praktisch vorgestellt? Wollen Sie jetzt alle an meinem Schreibtisch Platz nehmen?“ „Nein, das natürlich nicht, aber…“. „Darf ich Sie als ‚Demokraten‘ (unüberhörbar vergiftet) daran erinnern, dass ich von der Bevölkerung gewählt worden bin“, unterbrach ihn der Malmsheimer, „während Sie sich selbst ernannt haben?“ Die beiden Pioniere blickten fragend zum Anführer, sollte man den Kerl verhaften? „Nein, nein“, sagte der Kuhn, „Sie können meinetwegen bleiben, Sie kennen sich aus, aber alles, was Sie anordnen wollen, legen Sie mir zur Genehmigung vor. Als erstes müssen wir die Lebensmittelverteilung…“. „Wenn Sie glauben, das besser hinzukriegen, gerne. Meinen Sie, die Bauern liefern Ihnen mehr Milch als bisher?“ „Und ich möchte einen Schreibtisch mit Telefon.“ „Gerne, aber Sie sehen ja, nicht hier drinnen, viel zu eng hier. Ich schlage vor, auf dem Gang.“ Mutschler ballte die Fäuste, Siemen und Haag traten unwillkürlich einen Schritt vor. Dem feinen Herrn Malmsheimer musste man mal in die Fresse hauen, damit er kapierte. „Das mit dem Telefon“, sagte der, „ist nicht so einfach, wie Sie denken.“ „Morgen Abend“, sagte der Kuhn fest, „nach der Arbeit komme ich her, dann ist das geregelt. Und den Schreibtisch stellen wir ins Ratszimmer. Mit Telefon. Wir gehen dann mal. Ach, ja, und die Schlüssel, bitte.“
Der Landjäger Weiß war kein Feigling, aber jetzt war ihm doch etwas mulmig zumute. Schwitzen im November! Gern hätte er sich am Kopf gekratzt, aber das ging ja nicht, wegen der verfluchten Pickelhaube, die überall sonst schon abgeschafft war. Er stand im Hof des Bauern Mößner in Sigmarswangen, in welchem gerade ein frisch geschlachtetes Schwein vom Haken baumelte. Ein illegal geschlachtetes Schwein, leider. Der Metzger Müller hatte „vergessen“ es anzumelden, hatte sich vermutlich mit dem Mößner über die private Verwertung des Fleischs verständigt, an der Zentralen Versorgungsstelle vorbei. Für diese aber musste der Weiß das Schwein beschlagnahmen. Was wiederum die Frau des Mößner zu einem solchen Geschrei veranlasste, als ob sie selbst geschlachtet werden sollte. Was nun schon eine erkleckliche Zahl von Dorfbewohnern angelockt hatte, die immer deutlicher eine drohende Haltung einnahmen. „Zentrale Versorgung, was die zahlt, kannst du dir in die Haare schmieren“, hatte der Bauer dem Gendarmen gegenüber zu Protokoll gegeben, „sag das dem Malmsheimer!“ Der Metzger Müller hielt sich zurück. Er wusste, nur mit viel Glück würde er mit einem saftigen Strafbefehl vom Amtsgericht Sulz davonkommen. Geld spielt keine Rolle, davon gab es ja viel zu viel. Aber er kannte den Staatsanwalt, und der kannte ihn und würde wohl eher ein Berufsverbot beantragen. Den Weiß überkam es rettend in letzter Minute. „Wer redet hier von der Zentralen Versorgung? Ihr habt doch seit gestern einen Arbeiter- und Bauernrat hier. An den müsst ihr abliefern.“ Das besänftigte zwar den Mößner nicht, machte einen allgemeinen Aufruhr aber gegenstandslos. Das Schwein blieb im Dorf. Als Mühlstein am Hals der neugewählten Räte, die es zur allgemeinen Zufriedenheit verteilen mussten.
Der Branerbäck trotzte in der Spittelmühle noch ein paar Jahre vor sich hin. Die Anna war zu vielem bereit und versuchte es auch immer wieder. Der Kasper hatte sich vom Hass seines Vaters eher abgestoßen gefühlt. Erst im Sarg hatte der alte Braner wieder freundlich geguckt. Ob er die allseitige Erleichterung noch selbst gespürt hatte?
Aussprache und Aussöhnung mit dem Kasper waren überraschend leichtgefallen, und die Kathi hatte ihre Schwiegermutter gleich so richtig ins Herz geschlossen. Montags morgens trafen sich die beiden Braner-Frauen, wann immer es ging, im „Café Krämer“. Als dann noch die Edeltraud Bronner dazustieß, entstand so ein Triumfeminat von beträchtlichem intellektuellem und rhetorischem Ausmaß, wobei für Letzteres eher die beiden jungen Frauen zuständig waren.
5. Vier blutige Anfänger und ein Machtmensch
November 1918 bis April 1920, Sulz.
„Ach die“, sagte der Malmsheimer am Abend des „Zwergenaufstands“ im Treppenhaus des Oberamts zum Gunzenhäuser, „die haben wirklich keine Ahnung. Statt das Rathaus zu besetzen wie überall sonst, sind sie gleich wieder gegangen. Und die Kasse musste ich ihnen nicht mal verweigern, sie haben schlicht nicht daran gedacht.“ „Demokraten halt“, sagte der Oberamtmann, „was wollen Sie erwarten? Ungehobeltes Volk, und ihren Friedrich Engels über die Französische Revolution haben sie nie gelesen.“ „Was wir ihnen aber nicht zum Vorwurf machen wollen“, rief der Schultes, schon im Abgang. Den Gunzenhäuser konnte er auch nicht leiden.
Das kurze, ereignisreiche Leben des Sulzer Arbeiterrats glich am ehesten noch dem des biblischen Dulders Hiob, nur, dass kein Gott ihn schließlich erlöste. Die von oben verordnete Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Verwaltung scheiterte am Unwillen der Bürokraten, die sich, wo immer es ging, darin gefielen, zu bezweifeln, zu verschleppen, zu bedenken, zu prüfen, zu vertagen. Über Finanzmittel verfügten die Räte nicht. Den Genossen, die in rascher Folge einander im Vorsitz ablösten, war gemeinsam, dass sie nach einmaligem krachenden Scheitern nicht weiterkämpften, sondern genervt hinwarfen. Oder nach internen Meinungsverschiedenheiten. Oder nach öffentlich geäußerter Kritik. Oder weil die Frauen nicht mitspielten. Dabei hätten sie doch so stolz sein können: Wann hätten denn schon mal in der Geschichte die Frösche der Trockenlegung des Teiches zugestimmt? Im Dezember tagten in Berlin die Delegierten aller deutschen Arbeiter- und Soldatenräte und beschlossen ihre eigene Abschaffung! Nicht Rätedemokratie, sondern parlamentarische, repräsentative! Sie gaben die Macht an das Volk zurück, in dessen Auftrag sie gehandelt hatten. Das war nun freilich eine Mehrheitsmeinung, und der Genosse Kuhn schloss sich dieser nicht an. In Rottweil ließ der Rat 20 Häuser bauen, in Schramberg wurde der Achtstundentag durchgesetzt. In Sulz leistete sich Kuhns Nachfolger, Paul Seidel, einen Machtkampf mit Ferdinand Roth, was zu einer Spaltung der Rätebewegung und letztlich zu ihrer Bedeutungslosigkeit führte. Albert Braun aus Holzhausen war der letzte Mohikaner und kämpfte gegen Malmsheimer und seine Kumpane für eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln und Brennholz. Vergeblich. Am 1. April 1920 griff in ganz Württemberg die Selbstauflösung.
In Sulz glaubten ja viele, dass die Toten sich erst nach einer Weile ganz vom Diesseits verabschiedeten. Dann mussten sie allerdings auch dem Ferdinand Roth 14 Jahre später Gelegenheit geben, sich anlässlich der an seinem Grab gehaltenen Reden doch sehr zu wundern. Wie konnte man all die Kämpfe der ersten Jahre nach dem Krieg so übertünchen! Vergessen der Streit um die Wohnraumbewirtschaftung. Seine Kundgebung für Demokratie und die Republik am 1. Mai 1919, die Rolle als Arbeiterratsvorsitzender, verdrängt. Er war bloß noch ein hervorragender Bürger und, als Holzbildhauer, ein Künstler. Nicht erwähnenswert die bittere Fehde mit dem Malmsheimer, aber der war ja inzwischen regelrecht verhasst. Vergessen auch die Sache mit der Milch.
Die Milchverteilung war der erste Strick, mit dem der Schultes den Arbeiterrat abwürgen wollte. Hat leider nicht geklappt, dachte der Geist des Roth, auch dem Milchgemeindeausschuss, den der Malmsheimer zwei Wochen nach der Revolution gründete, lieferten die Bauern keine Milch zur Verteilung ab. Was hätten sie mit dem Erlös anfangen sollen? Aber dem Arbeiterrat, der auch Milch und Lebensmittel verteilen wollte, schadete das natürlich enorm. Dann beauftragte Malmsheimer einen Gemeinderatsausschuss, bestehend aus einem Kuhhalter und drei Milchabnehmern, mit der Überwachung und Kontrolle der Mindestablieferung; natürlich um dem Arbeiterrat zu demonstrieren, wie man so was anstellt. Und wollte sogar sich verweigernde Bauern scharf bestrafen. Lauter Schüsse in den Ofen! Nein, nicht ganz, musste der Roth zugeben, die Milchabgabe an Ziegenbesitzer wurde eingestellt. Aber die reichen „Kurfremden“ wurden nicht vertrieben, die Hamsterer nicht verknackt. Mit diesen Maßnahmen, erinnerte sich der Roth, hatte der Bürgermeister zwar den Arbeiterrat dumm aussehen lassen, aber zugleich sich selbst angreifbar gemacht, war von seinem Olymp heruntergestiegen in die Arena. Dabei hatte er Anfang Januar 1919 einen wahren Geniestreich abgeliefert, einen wöchentlichen Gemeindeabend ins Leben gerufen, um die einsichtigen Kreise zusammenzubringen und jedermann, und ja, man geht mit der Zeit und der neuen Regierung, jeder Frau, die Gelegenheit zur Erörterung der wichtigsten Tagesfragen zu geben. So hatte er der Minderheit des Arbeiterrats eine breite Bürgerbeteiligung entgegengesetzt, die schon deswegen demokratischer aussah, weil sie, anders als die Räte, hierbei auch Frauen „Stimmrecht“ gab. Freilich konnte er die Farce nicht lange durchhalten, und, womit er gar nicht gerechnet hatte, jetzt musste er sich auch Kritik an seinen Entscheidungen anhören.
Wenn er’s recht bedachte, war der Ferdinand Roth ganz froh, dass er dieser Kakophonie entkommen war. Und machte sich endgültig davon.
6. Wie gewonnen, so zerronnen
Dienstag, 31. August 1920, Sulz.
Die Anfangsbegeisterung für die Demokratie hielt keine zwei Jahre. Der Versailler Vertrag schockte viele – was hatten sie erwartet, nach dem deutschen Diktat in Brest-Litowsk? Der Sieg an der Ostfront hatte nichts genutzt. Die deutschen Heere, die ein Imperium aus dem russischen Osten schnitten, fehlten gegen Amerikaner, Engländer und Franzosen. Und jetzt statt täglicher Siegesmeldungen: Inflation, Hunger, Arbeitslosigkeit, Bürgerkrieg. War es unterm Kaiser nicht besser gegangen? Hinzu kam für eine Weile der drohende Verlust des Oberamtsstatus. Pfarrer und Lehrer schimpften auf die neue Regierung, was das Zeug hielt. Schimpften? Schmähten sie als „Novemberverbrecher“.
Eigentlich wollte der Redakteur Bosch bei der Zerstörung der verhassten Demokratie in vorderster Front mitmachen. Allein, Malmsheimer hatte sich partout nicht einbinden lassen in seine Pläne, und an Weihnachten meldete sich sein alt und müde gewordener Körper mit Macht. Natürlich war nicht daran zu denken, den Kasper Braner zu seinem Nachfolger zu machen, auch wenn ihm dessen Mutter ein interessantes Kaufangebot vorgelegt hatte. Den Bosch schütttelte es bei der Vorstellung: Die „Sulzer Chronik“ in der Hand dieser vaterlandslosen Gesellen! Nein, er hatte einen würdigen Nachfolger gefunden. Und dass der als erste Amtshandlung den Braner hochkant rausgeschmissen hatte, war doch eine amüsante Fußnote. Zwar hatte sich der Kasper, dieses Kasperle, ans Kaufmannsgericht gewandt, aber Karl Haas, der Neue, war sich sicher, dass dieses gar nicht zuständig war: der Braner hatte nie einen Vertrag erhalten.
„Was schreibt dir der Bauderverein?“ Edeltraud Bronner drehte einen Brief in ihrer Hand. Sie war unerwartet früh nach Hause gekommen und hatte ihn vom Fußboden aufgelesen. Das war nun freilich der größte anzunehmende Unfall. Der Bronner hatte sich um Aufnahme beworben und kriegte jetzt also eine schriftliche Antwort? „Mach doch mal auf!“ Mit feuchten Händen riss er das Kuvert auf, überflog den Text. Und lachte laut auf: „Sie haben mich abgelehnt. Der Sänger-Ausschuss hat mich abgelehnt.“ Das konnte seine Frau ruhig lesen. Einen Grund hatten sie nicht angegeben. „Wir bedauern sehr… im Moment… leider von einer Aufnahme abzusehen.“ Dabei glaubte er zu wissen, warum die bigotte Altweibertruppe im Sopran und Alt auf seinen satten Bass verzichten wollte. Die Männer nahmen die Gerüchte um ihn und Larissa sicher eher nicht so wichtig.
Der neue Redakteur musste in jeder Ausgabe der „Chronik“ wenigstens einmal mit Dreck schmeißen. Pressefreiheit war doch eine feine Sache. So konnte er nach Herzenslust gegen die Regierung hetzen, die den Versailler Vertrag unterschrieben hatte, hatte unterschreiben müssen, angesichts der glaubwürdigen Drohung einer Besetzung durch die Sieger. Sozis waren beliebte Ziele, aber lieber noch trug er kräftiger auf. Spartakus, auch als es ihn schon gar nicht mehr gab, unter „Führung russischer und syphilitischer Geisteskranker“ wolle die Frauen kommunalisieren. Die großen Mietskasernen erzeugten Tuberkulose und Kommunismus. Dagegen hülfe nur „Hackenkreuz (!) und Christenkreuz“. Oder vielleicht doch Umsiedelung aufs Land? Aber das würden ja „all die jüdisch geführten Parteien“ verhindern. Deshalb, unter der Überschrift „Die Jüdinnen des Ostseebades Binz“, diese Meldung: Deutsche Kinder sind mangelernährt. In Binz essen Hunderte von halbnackten, fetten, feisten Weibern, meist jüdischer Rasse, ihnen die Sahne weg.
Da blieb selbst dem Bosch die Spucke weg.
7. Schlechte Gewohnheiten und ein guter Plan
Montag, 1. August 1921, Sulz.
„Die Roten demonstrieren mit den Schwarzen. Das ist das einzig Gute an der Sache.“ Das Triumfeminat empfand die Zeitläufte als zunehmend apokalyptisch. Die Ermordung des „Erfüllungspolitikers“ Matthias Erzberger vom Zentrum, den viele für alles verantwortlich machten, von der Niederlage bis zur Inflation, durch rechtsradikale Terroristen, hatte einige hundert Arbeiter und Handwerker mit umflorter roter Fahne auf den Marktplatz getrieben. „Ob der Haas sich wenigstens ein bisschen geschämt hat?“, grübelte die Edeltraud. „Natürlich, direkt zum Mord hat er nicht aufgerufen.“
„Lieber Behringer, aber klar!“ Wenn es nicht um Löhne oder gar Streiks ging, konnte Ferdinand Dietz, Herr im Hause der Süddeutschen Möbelfabrik, durchaus freundlich wirken. Vor seinem Schreibtisch standen „sein“ Gewerkschaftsvorsitzender Thomas Behringer vom Holzarbeiterverband und Karl Bertrand, Schreinermeister, den Dietz so gern zu sich zitierte, um sich immer wieder zu vergewissern, dass die Zeiten von „Bertrand & Baum“ vorbei waren. Neben seinem Sessel, auch wie immer, hechelte die riesenhafte Dänische Dogge, die aber heute ebenfalls freundlich gestimmt schien. Die Belegschaftsvertreter hatten darum gebeten, aus den anfallenden Holzresten mit Hilfe der werkseigenen Maschinen Puppenmöbel herstellen zu dürfen. Die Inflation war den Löhnen einfach immer um mehrere Schritte voraus. „Wir ziehen einfach eine Strompauschale ab. Es muss aber jedem deutlich werden, dass dieser Zusatzverdienst nicht der Gewerkschaft zu verdanken ist. Ich habe gehört, Malmsheimer will die Obstverpachtung jetzt auch für Arbeiter öffnen. Ihr seht, wir tun, was wir können.“
„Frauen-Radrennen! Was denn noch?“ Gottlieb Schmid, Gründer des Arbeiter-Radfahrvereins Pfeil Bergfelden, inzwischen, nach unqualifizierter Kritik an seinem Führungsstil, bei der Konkurrenz, dem Arbeiter-Radfahrverein Wanderlust Bergfelden im Arbeiter-Radfahrbund Solidarität, regte sich immer noch sehr leicht auf. Den Wanderlust-Oberen Friedrich Schaible beeindruckte er nicht. „Seit zehn Jahren fahren Frauen schon bei uns mit, und ich für mein Teil kann verstehen, dass sie die ewigen Schneckentouren leid sind.“ Schneckentour, so nannten sie im Verein durchaus zweideutig die Wettbewerbe, bei denen die Siegerin in der vorgeschriebenen Zeit „geradeausfahrend“ die kürzeste Strecke, ohne abzusteigen oder vom Rad zu fallen natürlich, zurückgelegt hatte. „Schlage vor, wir probieren’s.“
Das Triumfeminat war in der Zwischenzeit bei der Kommentierung weiterer Apokalypse- Vorzeichen gelandet. Das Verbot für Männlein und Weiblein gemeinsam im Neckar zu baden – da prusteten sie aber erst mal los. Schließlich war es Stadtgespräch, dass ausgerechnet eine resolute Krankenschwester ein prominentes Mitglied der Verwaltung vorm Tod durch Ertrinken gerettet hatte. Und da fielen ihnen eine Menge männlicher Sprüche ein, die immer neue Lachsalven auslösten. Wäre es für den Fortgang der Zivilisation nicht notwendig gewesen, die Dame hätte sich an die Verwaltungsvorschrift gehalten? Gehorsam! Opferbereitschaft, die eigenen Bedürfnisse hintanstellen, das zeichnet uns Deutsche aus. Jeder auf dem Platz, auf den der liebe Gott ihn gestellt hat. Wo gehobelt wird… Es dauerte eine ganze Weile, bis sie wieder bereit waren für Analyse und Empörung.
Warum mussten Lehrerinnen nach Verehelichung ihren Beruf aufgeben? Warum wurde in Geburtsanzeigen immer nur der Vater, nicht jedoch die Mutter erwähnt. „Geburten“, las die Anna vor, „Fabrikdirektor Albert Schloz 2 Töchter“ Überhaupt, die „Sulzer Chronik“! „Seilhüpfen ist Mädchen abträglich“, lachte die Kathi, „Schlafen bei offenem Fenster gesundheitsschädlich. Aber der Hammer ist der jüngste Leserbrief. Männer sollen allen Ernstes ihre Frauen in die Wahlkabine begleiten, damit sie nix falsch machen.“ Die Anna hatte über diese Missstände gründlich nachgedacht und war zu einem Ergebnis gekommen. „Ich bin ja nun in der SPD“, sagte sie, „und muss da schon dicke Bretter bohren. Aber sie hören wenigstens zu. Was wir brauchen, sind Frauen in allen Parteien, die die Republik wollen. Kathi, könntest du nicht in die DDP eintreten? Edeltraud, du bist katholisch, du könntest Mitglied im Zentrum werden. Getrennt marschieren, vereint schlagen!“ Bedenken wurden vorgebracht und ausgeräumt, Pascha-Bastionen geschleift, praktische Vorschläge zur Vereinbarkeit von Familie und Politik abgewogen und schließlich genehmigt. Unbewusst waren sie ja schon lange in dieser Richtung unterwegs. Bubikopf und Emanzipation eben. Bubikopf trug die Anna schon. „Aber wenn unsere Männer uns das nicht erlauben?“, warf die Kathi als letzten Einwand ein. „Kein Problem“, sagte die Edeltraud schelmisch, „wir Frauen haben da Mittel.“ Sie lachten.
8. Wann wir schreiten Seit' an Seite
Donnerstag, 20. September 1923, Sulz.
Wenn er an die von Schmissen zerhackte Fresse des Arbeitsrichters dachte, wunderte sich der Kasper Braner immer noch, dass der ihm ein wirklich faires Verfahren gewährt hatte. Offenbar konnte auch so einer umlernen. Geholfen hatte es freilich nicht: „Können Sie denn wirklich gar nichts Schriftliches vorweisen?“ Aber er hatte Glück gehabt, eine Stelle als Pförtner in der Buntweberei BWS ergattert und war mit einem Schlag sogar in den Genuss regelmäßiger Arbeitszeiten gekommen. Was, wie ihm der Betriebsratsvorsitzende Jakob Stockburger eingebläut hatte, ein Ergebnis der Kämpfe des Textilarbeiterverbands war. Und so, wie er sich früher auf die internationale Politik geworfen hatte, so wühlte er sich jetzt durch die Labyrinthe der einheimischen Sozialpolitik. Hatte mit dem Stockburger zusammen erst die ironische Theateraufführung „Teure Heimat“, dann, als die Betriebsleitung immer noch nicht begriff, den Warnstreik vom 22. Mai organisiert, war gegen den Widerstand von Frau und Freund in die KPD eingetreten. Blieb aber der Idee von der Einheit der Arbeiterklasse, der er sich jetzt zugehörig fühlte, verbunden, und steckte mit Keck hinter der Erzberger-Demonstration. Hatte sich mit ihm über die Annahme der „Wirtschaftsbeihilfe“ der BWS für ihre Arbeiter ein Jahr später so zerstritten, dass zum 1. Mai die SPD, die darauf beharrte, dass solche „Bestechung“ nur auf die Spaltung der Arbeiterschaft zielte, nicht mal eingeladen wurde. Nur um sie am 4. Juli alle zusammenzurufen zum Demonstrationsstreik gegen die Ermordung Walter Rathenaus. Stockburger donnerte vom Rathausbalkon: Wir müssen die reaktionären Drohnen in ihre Löcher zurücktreiben! Das Bündnis hielt sogar noch jetzt, in der aberwitzigen Inflation. Die Betriebsräte von BWS und den Möbelwerken gingen aufs Rathaus, machten gemeinsam Druck im Gemeinderat. Der ließ sich Notstandsarbeiten nicht abringen, kaufte aber ein Rind und verteilte das Fleisch, subventionierte pro Kopf 20 Pfund Weizen, besorgte Kartoffeln in Pommern, die jedoch bei der Ankunft in Sulz verfault waren.
„Und dafür willst du die Stadt loben?“, fragte der Keck ihn geradezu ungläubig. „Siehst du denn nicht, dass du hier den Kapitalismus nur in die Knie zwingst, weil es Menschen gibt, die Rinder oder Kartoffeln gegen wertloses Geld hergeben?“ Kathi hieb in dieselbe Kerbe: „Dem Arnfried Richter hat die Stadt neulich ein Darlehen von 1913 über 25.000 Mark zurückgezahlt, dafür kannst du nicht mal ein einziges Bonbon kaufen.“
Ja, der Kasper musste noch viel lernen, bevor er einen festen Standpunkt bezog, von dem aus er die Welt verstand. Was der Stockburger „die Parteilinie“ nannte. In der heutigen Sitzung des Betriebsrats würde der Braner vorschlagen, statt einer Lohnerhöhung pro Kopf und Woche dreieinhalb Meter Stoff zu fordern. Der Winter stand vor der Tür, und den täglich ausbezahlten Lohn zu erhöhen, machte schon lange keinen Sinn mehr.
9. Geplatzte Träume
Sonntag, 28. September 1924, Sulz.
Erst als alles schon kaputt war, war die Beziehung öffentlich geworden. „Danke für deine Liebe!“, hatte Larissa Salmen in das schmale Bändchen mit Gedichten von Paul Schmid geschrieben, „ich hab‘ mich ihr gerne hingegeben.“ Das war an Bronners 40. Geburtstag gewesen, noch im vorletzten Kriegsjahr, aber so alles überwältigend schön und nötig und richtig ihre Beziehung auch war, er hatte sich nie durchringen können, seine Familie zu verlassen und sich zu ihr zu bekennen. Und dann hatte Larissa ihre Stelle in der Volksbibliothek des Oberlehrers Schöpfer im Haus des Friedrich Tag am Marktplatz gekündigt und war nach Berlin gegangen. Offenbar konnte sie ohne ihn leben. Aber er? Ihre Briefe und das Bändchen bewahrte er in der Tischschublade seines Seminarraums auf, des Raumes, der dann am 15. November, wahrscheinlich durch eine Ofenexplosion, sagten die Feuerwehrleute, in Brand geriet. Die angesengten Schulmöbel warfen sie auf die Straße, der Inhalt der Schublade verteilte sich auf dem nassen Pflaster und wurde von einem der zu Hilfe Geeilten der Edeltraud übergeben, als er gerade Annas Ungetüm von Überseekoffer durchs Treppenhaus schleppte. Und Annas Dank dafür erschöpfte sich rasch, noch vor seiner Frau hatte sie ihn rausgeworfen. So war er wieder in der Dachkammer in Ernst Caspars Haus in der Unteren Hauptstraße gelandet, ohne irgendeinen Dunst, wovon er wie leben konnte. Seine Militärpension reichte gerade mal für zwei Schachteln Zigaretten. Ein Sparbuch hatte er nie besessen. Aber das war eh schon egal, da wäre jetzt, nach der Währungsreform, auch nichts drauf gewesen. Von Sorgerecht war in dem ungeregelten Zustand keine Rede, aber er wollte wenigstens in der Nähe seiner Kinder bleiben. Die freilich fanden ihn zunehmend peinlich.
Genauso schlimm: zu seinen alten Freunden Braner und Keck ins „Wiesental „traute er sich nicht mehr, und sie suchten ihn auch nicht auf. Stattdessen saß er jetzt bei Figuren wie dem Gipsermeister Steeb, dem Seilermeister Lörcher, dem Hauptmann a.D. Kündinger und dem Dentisten Graf im „Schwanen“. Die hatten alle zwei Dinge gemeinsam: einen Hass und ein Idol. Der Steeb, ehemals USPD, auf seinen Bruder Wilhelm, dem er bei der Gemeinderatswahl unterlegen war, der Lörcher und der Graf auf die schlechten Zeiten, der Kündinger auf die Siegermächte, den Versailler Vertrag, die „Erfüllungspolitiker“. Auf letztere den größten. Ihr Idol ein kreischender Österreicher namens Hitler, der am liebsten mit einer Reitpeitsche auftrat, und eine schier unerklärliche Attraktion auf Frauen und Menschenmassen ausübte. Derzeit saß er allerdings im Gefängnis, wegen eines kläglich missglückten Putschversuchs in München. Meistens zahlte der Kündinger, der jederzeit flüssig war. Hyperinflation, Währungsreform, Mark, Dollars, Zigaretten, Rentenmark, Reichsmark, egal. Er schob auch immer wieder dem Bronner, der sich sonst als Gelegenheitsarbeiter durchschlug, sogenannte Kurierfahrten zu, meistens nachts, oft auch zu toten Briefkästen. Manchmal, das merkte der Ex-Gefreite natürlich sofort, ging’s dabei um Schusswaffen. Immer aber handelte es sich um ein anderes Auto, welches er kurzschließen und nach Auftragserledigung an irgendeinem Bahnhof abstellen musste, von wo aus er dann die Rückreise antrat.
„Bronner, du bist doch auf einem solchen Schiff gefahren!“ Kündinger und Co. planten eine Gedenkfeier für den Kleinen Kreuzer „Karlsruhe“, der vor zehn Jahren, am Mittwoch, 4.11. 1914, 300 km südwestlich vor Trinidad explodiert war. Gleich nach der legendären „Emden“, die fünf Tage später zusammengeschossen auf den Cocos-Inseln vor Australien strandete, war sie der erfolgreichste deutsche Kaperkreuzer im Großen Krieg gewesen. Vergeblich versuchte der Bronner, den seekriegsbegeisterten Landratten die Idee auszureden. Sein Schiff war jeweils ein Truppentransporter, ein umgebautes Handelsschiff der Reederei Woehrmann, gewesen, nicht zu vergleichen. Das war aber egal, fanden seine Kumpane, man brauchte eine Art Gegenrede gegen die zu befürchtende Suada des unvermeidlichen Herrn Böhm, die sich wie Mehltau über die Feierlaune legen würde, eine lose Sammlung von Anekdoten, humorvoll, über Fußschweiß, Fürze, Puffbesuche, strenge, aber gerechte Vorgesetzte, dumme Eingeborene, diktatorische Küchenbullen. „Die heißen Smutjes bei der Marine“, versuchte er eine letzte Gegenwehr, dann gab er auf. Die Wände, das war die Idee des Dentisten Graf, würde man mit Plakaten schmücken, auf denen die Namen der von der „Karlsruhe“ bekämpften 17 Fracht- und Passagierschiffe standen, von „Bowes Castle“ bis „Royal Sceptre“, 76.000 Bruttoregistertonnen gekapert. „Hat einer von euch die Fotos und Zeichnungen gesammelt?“ Nein, aber sie würden den Redakteur Haas fragen.
Richard Beeg, der neue, reichlich mit Vorschusslorbeeren bekränzte Schultes, brütete über der Vorlage für die Gemeinderatssitzung. Der von Inflation und Währungsreform ausgelöste Volkszorn über die durch den völligen Verlust der Sparguthaben und Altersrücklagen eingetretene Enteignung, hatte sich nach einem halben Jahr mit Streiks und Hungermärschen in einen unterirdischen Schwelbrand verwandelt. Bedrohlich, aber nicht immer sichtbar. Die Stimmung in der Stadt hatte sich etwas aufgehellt; es war Zeit, Ballast über Bord zu werfen. Wie sein unter schrecklicher Katzenmusik abgewählter, zum Schluss allseits verhasster Vorgänger Malmsheimer, war auch Beeg davon überzeugt, dass nur private Initiative die Arbeitslosigkeit in der Stadt beseitigen könne.
Weg mit allem, was nach Gemeinwirtschaft roch! Er schrieb: § 2, Auflösung der gemeinderätlichen Kommission „Stollenführung des Aistaiger Überlandwerks ins Weilertal“. Ein Stausee zur Elektrizitätsgewinnung! An sich war die Idee ja nicht schlecht. Und den Stollen, soweit er von der Firma Kläger schon vorgetrieben worden war, konnte man ja erst mal belassen, bis vielleicht ein privater Investor kam. Und er hatte gleich noch eine Idee, wie man den Zorn von Kläger ablenken konnte: § 3, Zukunft der Baugesellschaft. Das war nun freilich ein geradezu genialer Schachzug, beglückwünschte Beeg sich selber. Die Baugesellschaft, die nicht Baugenossenschaft heißen durfte, das klang zu sozialistisch, war das Produkt eines vierjährigen Streits um die angemessene Zuteilung der städtischen Grundstücke an der Stuttgarter Straße. Ursprünglich gegründet, um das Rathaus-Monopol auf Begünstigung gezielt ausgesuchter Antragsteller zu sprengen, war durch Malmsheimers „feindliche Übernahme“ ein scheinbar gemeinderatsfernes Gremium zur Vergabe entstanden, in welchem die Verwaltung zwar in Vorstand und Aufsichtsrat Schlüsselpositionen mit „eigenen“ Figuren besetzt hatte, aber offiziell nicht verantwortlich war, wenn es am Biertisch Streit gab. Und jetzt würde der Gemeinderat eben beschließen, dass städtische Kredite und Zuschüsse nur noch ein Jahr lang fließen würden. Hei, das würde so manchen Arsch vom Sessel lupfen.
10. Unser der Sieg, trotz alledem! Sagt wer?
Freitag, 8. Mai 1925, Sulz.
Wie ein Atoll im Ozean, dachte der Zentrums-Ortsvereinsvorsitzende Greiner, als er, wie jedes Jahr, zu seinem Landesvorstand nach Stuttgart fuhr, um Bericht zu erstatten. Der Ozean, das waren die Kräfte des alten Regimes, das Atoll die Erfolge der Demokraten. Dieses Jahr würde die schwarz-rot-goldene Beflaggung der Stadt zum Verfassungstag am 11. Mai klappen, das hatte er mit SPD und DDP abgesprochen. Im Vorjahr hatte den Oberamtmann Lang von Langen die Aufforderung des Innenministeriums zur Flaggenhissung in arge Verlegenheit gestürzt. Einerseits konnte er als Beamter sie nicht ignorieren, andererseits, was würde sein Honoratiorenzirkel dazu sagen, wenn der „Verfassungslappen“ auf seine Anordnung hin aufgezogen würde? Schließlich war die Annonce erschienen, aber erst am 12. Wofür sich Redakteur Haas krokodilstränenweinend entschuldigte. Ob es wohl Krokodile im Ozean gab? Je länger er darüber nachdachte, umso weniger befriedigte ihn die Atoll-Ozean-Metapher. Wie passten da die Kommunisten rein? Als Haie?
Fakt ist, sagte der Braner seiner KPD-Betriebszelle, dass in den Wahlen offenbar geworden war, dass die überwältigende Mehrheit der Wählerinnen und Wähler des Oberamts diesen Staat ablehnte. Allerdings sehr unwuchtig. Auf der Rechten Bauernbund, DNVP, Völkisch-Sozialer Block mit zusammen fast 5.000, auf der Linken nur sie mit 300 Stimmen. Dazwischen 3.000 Sozis, Katholiken, DDP- und DVP-Wähler. Bei der DVP wisse man eh nicht. Ob es klug war, fügte er lässig hinzu, dass das ZK Stalins Parole übernahm, die Sozialdemokratie sei der Zwillingsbruder des Faschismus, müsse bezweifelt werden, zumal die Parteilinie jetzt bereits zum zweiten Mal geändert würde: „Bis ’23 wollten wir die Einheitsfront, dann bekämpften wir sie als Sozialfaschisten, und jetzt, sagt Thälmann, ist wieder alles offen. Zusammen wären wir im Oberamt immerhin fünfzehnhundert stark. Ich bin der Ansicht, wir müssen uns gegen die Reaktion zusammentun.“
Der Stockburger war von Kecks luxuriöser, wie er meinte, Jagdhüttenausstattung widerwillig beeindruckt. Gefunden hatte er sie überhaupt nur, weil er gern den Wald durchstreifte auf der Suche nach Brennholz, Beeren, Pilzen, deren Fundorte er dann den Familien der Häusler und Gelegenheitsarbeiter verriet. Gelegentlich musste er dazu auch Ortsfremde vertreiben, denen solches Einsammeln streng verboten war und wie Obstdiebstahl bestraft wurde. „Wie wirst du denn in Sachen Schäfferstraße abstimmen?“, fragte er jetzt. Der Sulzer Oberamtmann Schäffer, empathischer Arm des Gesetzes, der den üblen Hannikel und seine Sippe zur Strecke gebracht und hatte hängen lassen, was nach Ansicht vieler Sulzer den großen Brand von 1794 zur Folge hatte, war den Kommunisten nicht deshalb verhasst, sondern weil er sozusagen einer der Erfinder der modernen Polizei war. Die, wie der Stockburger fand, wie ein Krake das ganze Land umgriff. Das Reichskommissariat für Überwachung der öffentlichen Ordnung hörte ja bis in seinen Ortsverein hinein. Das Oberamt schickte jedes Jahr eine Liste der Kommunisten nach Stuttgart. Geheim, streng geheim, wie jedermann wusste. Der Keck war sich unschlüssig. „Der Schäffer war gegen Folter und hat sich um die Kinder gekümmert; man muss fast sagen, der hatte ein soziales Gewissen.“ „Aber ein Fürstenknecht war er halt trotzdem“, beharrte der Stockburger, „und dich hätte er gleich als Wilderer aufhängen lassen.“ Schließlich lag der Keck mit der Verwaltung ewig im Streit über seine Jagdrechte. So schlug er ein. Er brauchte den Kollegen noch für seine Idee eines öffentlichen Waschhauses in der Wollehalle.
Lina Leng, Tochter des amtierenden SPD-Ortsvereinsvorsitzenden, hatte die Freistelle bei der Realschule gleich zweimal ergattert, weil sie ausweislich ihrer Noten ein „Mädchen mit ganz besonderer Begabung“ war. Jetzt trat sie eine Lehre beim Bestattungsmeister Ewald an. „Gestorben wird immer“, hatte die Mutter zustimmend die Wahl kommentiert, die bei ihren Schulfreundinnen eher auf Befremden stieß. Die warteten freudig erregt auf die Arbeitsplätze im neuen Spinnereigebäude. Wozu eine Lehre, wenn frau gleich als Anlernling richtig Kohle machen konnte! Und den Eintritt in den Textilarbeiterverband sparten sie sich auch: die Arbeitgeber zahlten allen den Lohn, den die Gewerkschafter mit ihren Beiträgen erstritten hatten.
11. Der dünne Firnis der Zivilisation
Donnerstag, 25. Mai 1933, Sulz.
„Hast du schon gehört, der Jakob Brodbeck ist gestorben?“ „Kein Wunder“, sagte der Ernst, „so wie der aus dem KZ zurückkam. Nach einem Monat!“ Er klang fast gleichgültig. Es war eh schon fast alles egal. Es war einfach zu viel. Wir hatten keine Chance, und wir haben sie nicht genutzt, dachte der Kasper. Keck hatte Recht. Deutschland, Dichter und Denker. Jetzt, Gelichter und Henker. Es war nicht zu fassen, was da an die Macht gekommen war. Nach Wahlen! „Er war doch immer anständig!“, hatte seine Mutter dem Bürgermeister Wiedmayer entgegengeschrien, nachdem sie den Jakob abgeholt hatten. „Tun Sie was!“ „Ein Kommunist war er“, hatte der erwidert und sich abgewandt. Jakob Stockburger saß immer noch im KZ auf dem Heuberg, es hatte in der Zeitung gestanden. Auch andere waren verhaftet worden, niemand wusste, wo sie waren. Der Keck vermutete, auch ihn würden sie bald holen. Drei Jahre lang war er die Speerspitze des Aufstands der Anständigen gegen die braune Flut gewesen. Hatte unerschrocken seinen beißenden Witz in ihre Versammlungen getragen, sich die Finger wund geschrieben, Verbündete ermutigt, sich gar auf die pseudo-religiöse Propaganda der Nazis eingeschossen, mit dem katholischen Pfarrer Rebstock und seinem Zentrum Wahlkampf gemacht, zu einer Zeit, als den evangelischen Kirchengemeinderat „die verheerenden Wirkungen der Karnevalsunsitten“ mehr plagten als der Zulauf der Nazis. „Dummheit ist bekanntlich Gottesgabe, aber ja nicht missbrauchen!“, hatte er in einem Leserbrief gewarnt. Und geahnt: „Sollte mir auf dem Heimweg einmal etwas passieren, weiß man ganz genau, wo die Täter zu suchen sind.“ „Juden haben keinen Zutritt!“, plakatierten diese, und die Familie des Benno Kappenmacher verstand und zog nach Haigerloch. Somit gab es im ganzen Oberamt keine „israelitischen“ Mitbürger mehr.
Wirtschaftlich war es in Deutschland nach der Währungsreform endlich wieder aufwärts gegangen, politisch kehrte es in den Kreis der „zivilisierten“ Nationen zurück, wurde gar Mitglied im Völkerbund, betrieb Versöhnung Richtung Frankreich, wenn auch nicht mit Polen, radikale Kräfte schienen fünf Jahre lang zurückgedrängt. In Berlin steppte der Bär. Aber Hass und Verachtung saßen tief. Die Vernichtung der Sparguthaben wurde nicht dem irren Krieg der alten Monarchie angelastet, sondern der jungen Demokratie, die deren Erbe übernahm. Weltkriegsgeneräle hetzten gegen Räte, Demokraten, Juden, Franzosen. Lehrer, Pfarrer, Redakteure, Richter, Polizisten betrauerten die „gemeuchelte“ Monarchie. Das alles gab es in Sulz auch. Aber mit dem Unterschied, dass der wirtschaftliche Aufschwung hier nie wirklich ankam. Als im Gefolge der Weltwirtschaftskrise die Nazis wieder Rückenwind spürten, konnten sie auf all diese Ressentiments zurückgreifen. Zu allem Unglück hatte sich auch in Sulz die kommunistische Parteilinie mal wieder gegen die Sozialdemokraten gewandt, was den Braner schließlich, wie Keck sagte, erst zur Verzweiflung, dann zur Vernunft brachte. Er hatte die KPD wieder verlassen. Der Keck hoffte aber vergebens auf seine Rückkehr.
„Was ist eigentlich aus dem Hochmössinger Pfarrer geworden?“ Der hatte eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil er als erster und einziger dem SA-Sturm den Zugang zum evangelischen Gottesdienst verweigerte. Noch kostete das nicht gleich das Leben. Andere hätten das auch tun können. Die „gebildeten Stände“ benutzten die braunen Schläger gerne für ihre politischen Zwecke, grenzten sich aber verächtlich gegen das „Gesoxe“ ab. Am Totensonntag durfte es nicht mit den Großkopfeten am Ehrenmal stehen. Bürgermeister Beeg, Oberamtmann Stockmayer, Dekan Findeisen, die städtischen und Amtsbeamten, der Krieger- und Veteranenverein und die Musikvereine gestalteten die offizielle Feier. Erst am nächsten Tag, dem Montag also, durften auch die Nazis die Helden des Weltkriegs ehren. Aber so mancher Teilnehmer am Sonntag, wie der Leiter der Stadtkapelle, Scharrer, trug das braune Abzeichen schon unterm Revers. „Dabei fällt mir ein“, grinste der Braner, „so was hattet ihr doch auch schon mal.“ „Ja“, erinnerte sich der Keck, „das war noch zu Zeiten von Bertrand & Baum. Die haben ihre Arbeiter in einem Festzug durch die Stadt laufen lassen, Musik vorneweg, Besäufnis hinterher. Du weißt schon, Demonstration des herzlichen Einverständnisses zwischen Arbeit und Kapital. Das konnten wir natürlich nicht so stehen lassen, haben drei Tage später unsere Leute zum Gähnenden Stein hochgeschickt, Stadtkapelle, Reden Fahnen, kannst du dir ja vorstellen.“ „Ja, und es war knalleheiß, und die Leute im dicken schwarzen Sonntagsanzug.“ Sie lachten.
Lisa Leng konnte mit niemandem darüber reden, also schrieb sie es in ihr Tagebuch. Der Jakob Oesterle, Kommunist, Gewerkschafter, Nazi-Hasser, war ohne große Umstände auf ihrem Tisch gelandet, 15 Tage nachdem er verschwunden war. An der ersten Biegung des Mühlkanals war der Schnee zertrampelt, da sollte er hineingefallen sein. Seine Leiche fand sich schließlich am Stauwehr der Buntweberei. Staatsanwalt? Gerichtsmediziner? Tatortfotograf? Spurensicherung? Nichts dergleichen! Jeder wusste, der Oesterle verdingte sich nach zehn Stunden in der Möbelfabrik als Aushilfe im Hotel Pfisterwald, von wo aus er sich nachts auf den Nachhauseweg machte. Und Lisa hatte an seinem Körper Hämatome gefunden und am Kopf eine schwere Verletzung. Klar, hatte der Ewald gemeint, beim Reinfallen oder am Wehr. Wem willst du das melden? Und so hatte sie ihn zurechtgemacht in seinem einzigen Anzug, den Kopf ein bisschen zur Seite gedreht, damit nicht auffiel, wie sie die Wunde überdeckt hatte. Und er hatte eine schöne Beerdigung gekriegt, mit Trauer und Trost von der Gewerkschaft und der Firma und der KPD, und der Pfarrer Rebstock hatte sogar den Kirchenchor spendiert. „So stirbt mer uffm Dorf, juchhe!“, schreib die Lisa zum Schluss, dann starb sie eine Weile schier vor Angst, jemand könnte das Tagebuch finden. Aber wegwerfen wollte sie’s dann doch nicht.
Fortsetzung folgt...

Autor:
Klaus Schätzle, geb. 1948
Lokalhistoriker mit ausgeprägter Schwäche für „Geschichte von unten“.
Kapitel 4: Demokratie
Autor:

Klaus Schätzle, geb. 1948
Lokalhistoriker mit ausgeprägter Schwäche für „Geschichte von unten“.
 In Sulz kann das Buch in der „Blass Erlebniswelt im Backsteinbau GmbH“ und bei der „Buchlese“ am Marktplatz erworben werden.
Erschienen ist das Werk im Verrai Verlag / Stuttgart mit der
ISBN 13: 978-3-948342-72-2.
In Sulz kann das Buch in der „Blass Erlebniswelt im Backsteinbau GmbH“ und bei der „Buchlese“ am Marktplatz erworben werden.
Erschienen ist das Werk im Verrai Verlag / Stuttgart mit der
ISBN 13: 978-3-948342-72-2. 