Raum für Aktionen, Menschen und Ideen

Ausstellungen
I am text block. Click edit button to change this text.

Konzerte
I am text block. Click edit button to change this text.

Lesungen
I am text block. Click edit button to change this text.

Kleinkunst
I am text block. Click edit button to change this text.

Seminare
I am text block. Click edit button to change this text.

Galerie
I am text block. Click edit button to change this text.
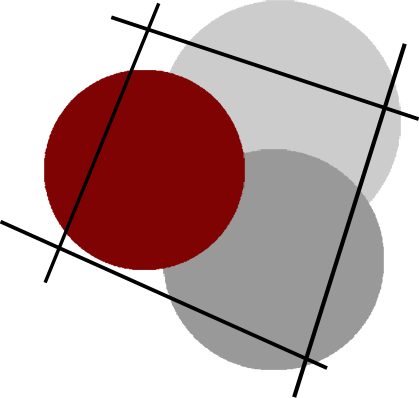
11. September 2021
1. Sulzer Kulturtag
EntdEcken
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
zeigen
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Staunen
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Unter dem Gähnenden Stein
(Sulz 1848–1948)
Kapitel 5: Verfolgung und Widerstand
1. Schatten, vorausgeworfen
Freitag, 3. Februar 1933, Berlin, Sulz, Warschau, Lodz (Polen), Mohilew (Ukraine), Czestochowa (Polen).
Reichsaußenminister Konstantin von Neurath feierte seinen 60. Geburtstag auf Einladung des Chefs der Heeresleitung, Kurt von Hammerstein-Equord, in dessen Privatwohnung mit der Crême der Generalität. Gekommen war auch der neuernannte Reichskanzler und schwadronierte schon seit mehr als zwei Stunden über Lebensraum im Osten und dass ein paar Millionen Ostische dem nicht entgegenstehen sollten. Von Hammersteins Tochter Helga, Mitglied der KPD, schrieb, hinter einem Vorhang versteckt, mit und würde am nächsten Tag Stalin unterrichten. Die Gäste reagierten herablassend bis unterkühlt. „Stets war die Rede kecker als die Tat“, zitierte einer Schiller, wenn auch falsch. Unvorstellbar, das alles.
Liberata Schätzle blickte auf einen ihrer „schlechteren“ Tage zurück, sie war nicht zur Arbeit gegangen, der immer gleichen Armbewegung am Furniertrockner der Möbelfabrik. Leon Czech freute sich, hatte er doch endlich Dana, die neue Arbeitskollegin, angesprochen und sie ins Café Szpilman in der ulica Karla Marka eingeladen. Richard Schmid, zu Besuch in der Kunstmühle, stellte sein Weinglas ab und blickte seinem Bruder Paul voll ins Gesicht: „Ich fasse zusammen: gegen die Braunen sind wir beide, aber du denkst, dieser Spuk geht von alleine vorbei.“ Paul, der Ästhet, dachte er, der Müller und Geschäftsmann. Wie hältst du es hier aus, dachte er, und wusste, das war ungerecht, und beschloss, ihm nicht zu erzählen, was er als Rechtsanwalt in Stuttgart über SA-Gewalttaten erfahren hatte. Gemeinderat Jakob Stockburger gratulierte sich, dass er vor acht Monaten die Arbeitsgemeinschaft der Neuhausbesitzer gegründet hatte, damit ließe sich vielleicht etwas organisieren. Über die nahe Zukunft seiner Partei und der SPD machte er sich keine Illusionen.
„Zeig doch mal!“ Jozefa war neugierig. „Die ist ja toll. Und deinen Namen haben sie auch eingraviert. C. Kudelski für 200 Spiele SKS Lodz 3.12.1933. Von Tissot, auch noch. Und du bist grade mal 15. Vielleicht wirst du ja mal richtig berühmt.“ Schwer zu sagen, wer stolzer war, seine Mutter oder Czeslaw selber. Galina hatte sich mal wieder in den Kuhstall geflüchtet. Da war es warm, und es schlug sie keiner. Lieber hätte sie mit dem Stanislaus gespielt. Aber „die Pochopiens sind keine Gesellschaft für unsereinen“. Henryk Sudecky spürte, wie ihm schlecht wurde. Ministrant beim „Großen Gebet“. Eine Stunde vor dem Altar knien, das war mörderisch für seinen 15 Jahre alten Kreislauf. Und er hatte irgendwie das Gefühl, dass die Schwarze Madonna ihm zublinzelte: Geh‘ ruhig raus. Ich wollte auch nicht so lange knien müssen.
SA-Obersturmmann Stickel hängte das Hindenburg- Foto weiter links, das Hitler-Portrait auf gleicher Höhe brauchte Platz, aber das Bild seines alten Feldherrn hinterließ sichtbare Ränder zwischen beiden auf der Blümchentapete. Da hatte er einen Geistesblitz. Aus der Truhe holte er das vor Monaten abgenommene Kruzifix und befestigte es über der Verfärbung. Das sah gut aus, fand er, und seine Emma würde es auch freuen. Er hob sein Bierseidel und prostete den dreien zu.
Der Anruf, den alle Eltern fürchten, kam um halb Neun. „Polizeiposten Sulz, Landjäger Engst. Wir haben eure Buben erwischt, wie sie ein Plakat vom Reichskanzler heruntergerissen haben. Ist Wilhelm zu sprechen?“ Das sei, sagte der Landjäger, eine letzte Mahnung. Bei der bekannten Einstellung der Familie würde es über kurz oder lang schrecklich enden. „Die SA lässt sich das nicht bieten, und ich kann es nicht verhindern.“ „Schon dein Vater, Wilhelm, war ja ein Kommunischd. Damit muss jetzt Schluss sein! Ihr solltet jetzt ums Verrecken nicht mehr auffallen!“ Wilhelm Braner, kreidebleich, versprach eine gehörige Tracht Prügel. Da hatte er die Rechnung aber ohne seine Frau gemacht. „Den ganzen Tag schimpfen und lästern, da brauchst dich net wundern!“
„Autsch!“ Frau Scharrer steckte den Finger in den Mund und saugte. Hatte sie sich doch beim Bügeln vom Anzug ihres Mannes, dem Leiter der Stadtkapelle, am Parteiabzeichen gestochen. „Was trägst es auch unterm Revers, wo’s keiner sieht!“, schimpfte sie. „Jetzt kannst es doch offen zeigen!“ Pfarrer Rebstock betrachtete nachdenklich das Konzept der Rede, die er ein Jahr zuvor auf der Zentrumskundgebung gehalten hatte: „Die Religionsauffassung der Nazis läuft der der katholischen Kirche diametral zuwider“. Dann zerriss er das Blatt. In seiner Dachstube schob der alte Kasper Braner seine geheimen Tagebücher in den hintersten Winkel des Kniestocks. Er hatte nicht mehr lange, das wusste er. Wilhelm würde sie nicht mögen. Der Alte hoffte auf die Enkel. Redakteur Haas zerriss ein Dankschreiben des Reichsbundes Jüdischer Frontsoldaten in Horb für den Abdruck einer Rede über „vaterländische Gesinnung“. Die Ernennung des nun schon dritten Reichskanzlers innerhalb weniger Monate hatte er mit einer müden Unterschlagzeile abgetan, dazu fünf Zeilen Text. Das war womöglich ein Fehler gewesen. Der Fackelzug der SA und die wilden Verhaftungen noch in derselben Nacht hatten ihn mächtig beeindruckt.
2. Aufräumen!
Donnerstag, 7. Dezember 1933, Sulz, Holzhausen, Vöhringen.
„Es ist mir selbst unerklärlich“, tippte der Landjäger Engst ins Vernehmungsprotokoll des Jakob Hetzel, „wie man sagen kann, ich häbe ‚Heil Moskau‘ gerufen.“ Unglaublich, womit sich ein Polizist im Führerstaat beschäftigen musste. „Dass Jakob Geiser in der Linde war, daran kann ich mich noch erinnern. Dass dieser aber zu mir sagte: ‚Jakob, spare deine Worte‘, das habe ich nicht gehört. Ich betone nochmals, dass ich nicht gegen die Regierung eingestellt bin, denn ich habe bei Sammlungen auch schon Stroh und Weizen hergegeben.“ Alle Zeugen, alle Beklagten, unzuverlässig, besoffen, schon lange aus der SPD / DDP / dem Zentrum ausgetreten, geistig minderbemittelt, nichts gehört. Nichts gesehen auch, dachte der Engst und grinste, als die Frida Plocher, Ringführerin der NS-Frauenschaft in Holzhausen, diverse Verfehlungen zur Anzeige gebracht hatte, wie „Der soll seine Schulden bezahlen“ oder „Alle Fehler hat er“, wo doch der Führer weder rauche noch trinke. Warum die Wilhelm Plochers nicht ins KZ gebracht worden seien, die ihren Kindern „die Füße abschlagen“ wollten, wenn sie mit dem Erntedankumzug gingen? Nicht verwandt, nicht mal verfeindet, nur staatbürgerliche Pflicht. Allein dieser vermaledeite Umzugsboykott füllte schon 15 getippte Seiten. Dazu hatte die Plocher Briefe geschrieben: ans Innenministerium, an die Politische Polizei, an Polizeidirektor Dreher. Leider waren alle Briefe verloren gegangen: versehentlich mit anderen Akten irgendwohin geschickt worden, oder aber „gingen sie mir beim Radfahren verloren,“ wie der Stationskommandant Stilz zu Protokoll gab.
Kreisleiter und -funkwart Eugen Beilharz tobte. Zum dritten Mal war die Führer-Rede auf dem Marktplatz übertragen worden, zum dritten Mal die halbe Stadt angetreten, und zum dritten Mal hatten unbekannte Saboteure mit Rückkoppelungen dazwischengefunkt. Volle zehn Minuten war die eh schon leicht zum Überschlagen neigende Stimme des Kanzlers zur Unkenntlichkeit zerschrillt worden. Herumfuchteln zum Anhören! Zum Glück hatte die SA den Marktplatz so umstellt, dass sich fast niemand davon machen konnte. Aber unbekannt! Das fuchste ihn am meisten. Was war denn daran so unmöglich, ein paar Wohnungstüren einzutreten? Die Geräte mussten ja noch warm sein. In rasender Eile tippte der Beilharz eine Notiz für die Zeitung: An die Radiobesitzer: „Es ist in letzter Zeit versucht worden, die Radioübertragungen durch unnötige Rückkoppelungen zu stören und wird unbarmherzig gegen derartige Störer vorgegangen. Es solle ja niemand glauben, dass man den Störer nicht entdecken könne.“ Der Haas druckte unverändert ab, inklusive des unangebrachten Konjunktivs. Zwar lag er politisch voll auf der Linie der neuen Machthaber. Aber ihre Sulzer Vertreter verachtete er.
Der alte Braner, der zu seiner eigenen Überraschung immer noch nicht seinem Lungenleiden erlegen war, hatte sein Tagebuchschreiben wieder aufgenommen. Stand heute befand sich kein Sulzer mehr im KZ. Auch die Kommunisten Stockburger, Rauch und Brodbeck waren wieder zu Hause. Falsch, der Jakob Brodbeck war ja gleich darauf gestorben. Im Frühjahr waren sie zu acht verhaftet worden. Zwei Monate, dachte der Kasper, zwei Monate hatten gereicht, sie ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen. Bis heute wusste er nicht genau, wer ins KZ, wer in „Schutzhaft“ verbracht worden war. Jakob Stockburger hatte sich wohl vorgenommen weiterzuleben. Ernst Keck war mit Gefängnis davongekommen, dann hatten sie ihn im Triumph durch die Stadt geführt, Schlinge um den Hals, und ihn angespuckt.
3. Wind säen
Sonntag, 12. Mai 1935, Sulz, Vöhringen, Schweizer Grenze Schaffhausen – Erzingen.
Zu den verherbungsfehigen Krangheiden, schrieb Adolf Bronner in sein Biologieheft, zälen Geschlechdskrankheid und Ferbrechertum. Und Alkoholissmus. Er schrieb seine Hausaufgabe in Schönschrift unter Aufsicht am Tisch in der Küche, seine Eltern und Geschwister waren im Gottesdienst, aber er, Adolf, hatte mit Hilfe des Großvaters durchgesetzt, dass er nicht gehen musste. Er war schon in Uniform, den Dolch dazu hatte ihm der Großvater auch geschenkt, und er hätte ihn am liebsten mit ins Bett genommen. Den Dolch, nicht den Großvater. Der roch so, als wäre er auch erbkrang. In einer halben Stunde würde die HJ antreten. Wie gut, dass Oma Edeltraud nicht mehr da war, dachte der Bub, die hätte wieder Zirkus gemacht. Und überhaupt, den Opa erst gar nicht ins Haus gelassen. Die vermisse ich gar nicht.
Dem Lang ist doch auch nix passiert, dachte der Vikar Schneeweiß und ließ den Blick über die Gemeinde schweifen. Prominent ganz vorne saß der Kreisleiter Beilharz, neben ihm seine Gorillas. Alle in der braunen Uniform. Zwar hatte die Gestapo den Pfarrer Lang schon dreimal abgeholt, aber jedes Mal wieder laufen lassen. Auf der anderen Seite gab es eben doch auch diese Meldungen: Gegen Geistliche, die die Heiligkeit der Kirche zu politischen Zwecken missbrauchen, wird aufs Schärfste eingeschritten! Die Kirchenleitung hatte sich voll hinter die Nazis gestellt, den Führerkult mitbetrieben, Glocken geläutet, Gottesdienste für die Braunen gehalten, sogar eine „Braune Hochzeit“ mitgemacht. In der Mordnacht vom 30. Juni letzten Jahres, dem sogenannten „Röhm-Putsch“, hatte der Evangelische Pressedienst „das gütige Walten des allmächtigen Gottes“ gespürt. 84 Mordopfer, gütig gewaltet! Die Kirchenverfassung forderte unter dem Arierparagraphen die Entlassung nicht-arischer Priester. Der Sulzer Dekan Findeisen und seine Frau waren glühende Verehrer des Führers. Und da ging der Lang hin und hielt eine Predigt „Und ist in keinem anderen Heil!“ Den Schneeweiß packte ein heiliger Zorn, gegen sich, gegen die Bande unter der Kanzel. „Siehe“, rief er, „ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, Matthäus 10, 16- 20.“ Das war ja nun gar nicht misszuverstehen. Dann fing das Warten an.
Bei den Lengs hing der Haussegen schief. Den Wilhelm, 1930 noch SPD-Vorsitzender, war es schon hart genug angekommen, dass seine Söhne Karl und Fritz in die HJ eintraten, nun machten sie da auch noch Karriere. Scharführer und Oberkameradschaftsführer waren sie nun, und wenn sie den Papa ärgern wollten, hielten sie ihm vor, dass das einem SS-Standartenjunker und -Oberjunker entspräche. Das wollten sie unbedingt noch werden. „Ist doch nur Spaß! Aber du musst uns auch verstehen.“ Sportabzeichen, Lagerfeuer, Ferientouren, Motorrad- und Fernmeldetechnik, das gabs alles umsonst. „Und die Kameradschaft, das ist das Beste!“ Zur Schwester, der „toten Lina“, hielten sie Abstand. Einmal, nach dem Schulungsabend im „Waldhorn“ über die „überschwappende Welle von Neger- und Mongolenblut“ hatten sie’s probiert. Ihr den Zeitungsartikel gezeigt, in dem von „herzlichem Beifall“ für den „Kampf gegen das jüdische Blut“ die Rede war. Die Lina hatte sie daraufhin gefragt, wie viele Neger, Juden und Mongolen hier im Oberamt zum Bekämpftwerden zur Verfügung stünden.
Die Glastür zum Coupé Erster Klasse wurde mit einem Ruck aufgerissen. Mit den beiden Grenzpolizisten drang auch eine Rußwolke ein. „Ihren Ausweis bitte! Nein, Sie nicht, Sie kenne ich allmählich.“ Der Rottwachtmeister Breinlinger guckte so harmlos, lächelte so freundlich. Und konnte doch jederzeit auf amtlichen Terror umschalten, wenn er Anzeichen eines illegalen Grenzübertritts zu erkennen glaubte. Das Gepäck des Rechtsanwalts Dr. Richard Schmid hatte er schon lange nicht mehr durchsucht. Der hatte ja nahezu jeden Monat in der Schweiz zu tun, war quasi ein alter Bekannter. Zu verzollen waren seine Prozessakten nicht. Jüdisch sah er auch nicht aus. O Breinlinger, wenn du das geahnt hättest! Die reichlich abgegriffene Mappe des Rechtsanwalts Dr. Schmid enthielt zwar Gerichtsakten. Mehrheitlich handelte es sich aber um hinaus- und hineinzuschmuggelnde Texte des sozialistischen Widerstands, zweite Welle. Die erste war mit der Verhaftung, KZ-Internierung und Ermordung der bekannten Nazi-Gegner gebrochen worden. Ein Kinderspiel für die Gestapo. Die zweite Welle bestand aus Antifaschisten, die bislang noch nicht so aufgefallen waren. Und so führte der Sulzer Rechtsanwalt heute diverse Aufsätze mit sich („Aufgabe der Sprache ist es, Mitleid mit den vom Regime Verfolgten zu verhindern.“), geheime HJ-Befehle („Ihr erscheint unentschuldigt nicht zum Dienst und geht privaten, persönlichen Vergnügungen nach. Bei euch gilt wieder das ‚liberalistische, marxistische Ich‘, ihr verneint das nationalsozialistische ‚Wir‘.“) und noch geheimere Berichte („Die Missstimmung wächst, weil die Arbeiter noch mehr zahlen müssen als in den Gewerkschaften und weil sie anstelle der roten Bonzen die braunen haben. Sie fordern Aufklärung über die Verwendung der Beiträge.“) Richard Schmid wischte sich vorsichtig einen Rußkrümel vom Ärmel und zündete sich eine Zigarre an. Zur Feier, sozusagen.
4. ...wenn sie mich nur fürchten
Donnerstag, 21. Oktober 1937, Gößlingen, Sulz.
16 Kerzen hatte sie in einem Atemzug ausgepustet, dabei war sie doch 18 geworden. Mira von Bern trugs mit Humor, an schlechte Omina glaubte sie eh nicht. Seit dem gestrigen Tag trug sie stolz die grün geflochtene Schnur der Mädelscharführerin. Die Blicke der jungen Männer zog sie nicht deshalb auf sich, das wusste sie. Und auch, dass sie selbst nur Augen für den schneidigen SS-Oberschützen hatte, den ihr ältester Bruder zu ihrem Ständerling mitgebracht hatte. Das Gespräch drehte sich – mal wieder – um den „Schwarzen Hetzer“ von Dautmergen, Pfarrer Adolf Staudacher, der seine Verurteilung wegen „Verunglimpfung“ der NS-Presse nicht hatte hinnehmen wollen. Aber jetzt hatte das Reichsgericht in Leipzig seine Revision verworfen. Mira hatte nicht viel übrig für katholische Pfarrer. Jeder wusste, wenn sie nicht messweinbefeuerten Schweinkram trieben, schmuggelten sie Devisen. Aber das war doch ein Hebel: „Und was sagt ihr zu den 260 Franziskanern, die sie jetzt wegen Unzucht angeklagt haben?“ Unzucht, schoss es ihr durch den Kopf, da wäre doch endlich mal jemand, mit dem ich glatt zum Franziskaner werden könnte.
Nicht mal zum Bahnhof hat sie kommen wollen, dachte der Albert Braner resigniert. Dass sie mich vor dem Knast abholt, hab‘ ich gar nicht erwartet, aber zum Bahnhof hätte sie doch wenigstens… Er wusste jetzt, was ihm daheim bevorstand: Ablehnung. Ob sie sich scheiden lassen würde? Immer und immer wieder hatte seine Frau ihn gebeten, sich von der Kirche zu distanzieren. „Wenn du schon nicht austrittst, bleib‘ wenigstens weg.“ Aber nein, er war Messner und war Jungscharführer und beabsichtigte, es zu bleiben, bis sie ihn abholten. Was sie prompt taten. Und Laienhelfer wurden vor zwei Jahren härter verfolgt als die Geistlichen selbst. Unzucht, das musste reichen, und Hetze gegen den neuen Geist hatten sie ihm vorgeworfen und zu zwei Jahren Gefängnis verknackt. Die „Hetze“ trug er wie einen Orden, aber als „überführter“ Sittlichkeitsverbrecher war er der allgemeinen Verachtung preisgegeben. Dabei hatte sich der Staatsanwalt nicht einmal die Mühe gemacht, seine „Taten“ genauer zu benennen. Ob er es mit seiner Jungschar, frommen Greisinnen oder Eselstuten getrieben hatte, spielte in der knapp halbstündigen Gerichts-„Verhandlung“ keine Rolle. Wohl aber, was er gegen die Übernahme des katholischen Kindergartens durch die NS-Volkswohlfahrt gesagt haben sollte. Aus seiner Rottweiler Zelle hatte er sich an den Kreisleiter Otto Beilharz gewandt mit der Bitte, sich für ihn einzusetzen. Der hatte schließlich ja auch den Schneeweiß geschont, ja, er hatte noch vor einem Jahr kirchlich geheiratet. Aber wenn er überhaupt reagiert hatte, war die Antwort im Papierkorb des Zensors gelandet.
Durfte man über einen Amtsbruder denken, man finde ihn zum Kotzen? Fast die gesamte Sulzer Prominenz, angeführt vom geschmeidigen neuen Dekan Schmid, war zur Verabschiedung von Pfarrer Rebstock ins Waldhorn gekommen. Der seinen Frieden mit den Nazis gemacht hatte, nachdem er sie doch vor dem 30. Januar so bekämpft hatte. Noch so’n Märzgefallener, dachte Pfarrer Ginter, ergrimmt, mit unbewegter Miene einem weiteren Heimatgedicht aus der fruchtbaren Feder seines Vorgängers lauschend, das dieser nun zum Höhepunkt der Feier selbst vortrug. Soso, am Gähnenden Stein willst du dereinst begraben sein, womöglich mit deinem Gedichtbuch im Sarg. Die wirst du doch am Jüngsten Gericht nicht schon wieder vorlesen wollen? Am besten, man legt gleich alle Exemplare dazu! Zur Verabschiedung von Pfarrer Lang war damals keine Sau erschienen, fiel ihm ein. Kein Wunder, der hatte den Philipp Tag begraben, das Sozenschandmaul, hatte sich mit den Entkonfessionalisierern angelegt und kannte sich überhaupt mit der Bibel besser aus als mit Knüttelversen. Wie gerne hätte der Ginter jetzt eine der angebotenen Zigarren geraucht, aber seine Brust schmerzte wieder. Seit er als Infanterist im Schützengraben von Thiepval den Lungenschuss abgekriegt hatte… Zum „Heimatschuss“ hatte er sich damals gratuliert. Wenn ich mal gehe, dachte er jetzt, wird auch keine Sau kommen. Zumindest hoffte er das.
5. "Zu Kundgebungen ist es nirgends gekommen"
Samstag, 27. und Sonntag, 28. August, Dienstag, 13. September 1938, Sulz.
Der Gendarmerie-Obermeister Röhrle konnte es nicht wissen, aber er ahnte, wie Goebbels getobt haben musste: „Die katholischen Bischöfe geben einen unverschämten Hirtenbrief heraus. Der übertrifft alles bisher Dagewesene. Ich lasse ihn beschlagnahmen und die betroffenen Druckereien enteignen.“ Vor ihm lag der Funkspruch der Geheimen Staatspolizeileitstelle Stuttgart an die Außenstelle Oberndorf: Dieser Hirtenbrief in allen Exemplaren war einzuziehen, und zwar in den katholischen Pfarrämtern von Sulz, Leinstetten und Binsdorf. „Konrad“, rief er den evangelischen seiner beiden Hauptwachtmeister, „hier, lesen, dann Abflug! Ellgott, du fährst erst nach Leinstetten und dann… nein, das dauert zu lange. Ich rufe in Binsdorf an.“
Pfarrer Ginter gab sich keinen Illusionen hin über das, was ihn nun erwartete. Widersetzliche Geistliche waren ins KZ eingeliefert oder unter fadenscheinigen Vorwänden verurteilt worden. Oder erst verurteilt, dann, nach Verbüßung der Strafe, ins KZ verbracht worden. Oder einfach nur zusammengeschlagen. Die Kirchenfürsten, denen sie folgen zu müssen glaubten, schützten sie nicht, konnten oft nicht, wollten manchmal nicht. Vom „Tausendjährigen Reich“ waren grade mal fünfeinhalb Jahre vergangen, die Braunen saßen fester im Sattel denn je, was von der Opposition übrig war, im KZ. Gerade hatte Österreich „heim ins Reich gefunden“. Die Nazis feierten einen Triumph nach dem anderen und konnten sich des Beifalls der übergroßen Mehrheit sicher sein. Die raffinierte Diktatur, eine Mischung aus Terror und Verführung, Chaos und Ordnung, Anpassungsdruck, Desinformation und „gesundem Menschenverstand“, verwirrte selbst die Gutwilligsten und ließ individuelles Widerstehen absolut sinnlos erscheinen. Und außerdem appellierte das Regime sehr geschickt von Zeit zu Zeit an den inneren Schweinehund, dem nicht nur seine Landsknechte, sondern auch brave Bürger gerne mal freien Lauf ließen. In der Haut vom Röhrle, dachte der Ginter, wollte ich nicht stecken. Eigentlich grundanständig. Da klingelte es schon.
Es war dann aber nicht der Röhrle, sondern der Hauptwachtmeister Konrad. Eintreten wollte er nicht. Den Hirtenbrief kriegte er nicht. Ginter musste mit auf die Gendarmerie- Inspektion. Bevor er ging, steckte er noch seinen Weltkriegsorden ans Revers. Auf Vorhaltung des Obermeisters Röhrle: „Seien Sie doch nicht so stur!“, dies schon fast flehentlich, erklärte der Stadtpfarrer, er habe einen Treueid geschworen und gedenke nicht, ihn zu brechen. Der Hirtenbrief enthalte den Vermerk, dass er „unter allen Umständen“ vorzulesen sei. Allenfalls das Begleitschreiben aus Rottenburg könne er herausgeben. Röhrle war erleichtert, schickte den Ginter heim und ließ den Konrad den Brief des Bischofs Sproll abholen.
Auf beiden Seiten setzte Nachdenken ein. So richtig gelöst war der Konflikt nicht. Ginter versteckte den Hirtenbrief in der Sakristei. Röhrle telefonierte mit der Gestapoleitstelle, die einen erneuten Versuch anordnete. Stunden später tippte der Konrad ein Protokoll: „Dabei schloss Stadtpfarrer Ginter die Sakristei auf und machte Licht. Ich selbst blieb an der Außenkante der Türschwelle stehen. Ginter forderte mich auf, hereinzukommen und den Hirtenbrief selbst zu holen. Den Stadtpfarrer Ginter forderte ich nochmals auf, den Hirtenbrief herauszugeben und ermahnte ihn an die Folgen bei einer Nichtherausgabe des Hirtenbriefes.“ So ging das eine Weile hin und her. Die Gestapo-Leitstelle Stuttgart hatte Anweisung gegeben, die Sakristei nicht zu betreten. So musste der Konrad schließlich „von der Sicherstellung des Briefes Abstand nehmen.“
In dieser Nacht schliefen einige schlecht. Röhrle war entschlossen, den Ball flach zu halten. Die SA sollte einen dekorierten Kriegsteilnehmer nicht noch einmal durch die Stadt treiben wie damals den Keck. Warum die Leitstelle so entschieden hatte, konnte er nur vermuten: Der Hitler steuerte via Sudetenkrise direkt die Zerschlagung der Tschechoslowakei an. Das bedeutete Krieg. Und die Hälfte seiner Soldaten war katholisch.
„O Herr“, betete Ginter in seinem Arbeitszimmer, „wie oft habe ich am Gründonnerstag die Liturgie verlesen. Heute kann ich zum ersten Mal nachempfinden, wie du dich im Garten Gethsemane gefühlt haben musst. Oder doch nicht, denn du hast ja gewusst, was auf dich zukam. Ich wollte, ich wüsste das auch. Aber dir ist auch keine Wahl geblieben.“ Ächzend erhob er sich vom Betstuhl, ging auf den Balkon, schaute zum Sternenhimmel hinauf. „Wo steckst du?“, murmelte er. Er ging wieder hinein, griff nach einer Zigarre. Jetzt kam es schon nicht mehr darauf an.
Erstaunlich, dass es den Schwarzwälder Boten immer noch gab, dachte Landrat Rayher. Und immer noch nicht völlig gleichgeschaltet. Aber auch die Oberndorfer hatten natürlich Hitlers Abschlussrede auf dem Nürnberger Parteitag auf die erste Seite gehoben. Er hatte ultimativ das „freie Recht der Selbstbestimmung“ und den Anschluss der deutschen Siedlungsgebiete in der Tschechoslowakei an das Deutsche Reich gefordert. Krieg lag in der Luft. Da würde er, in bester Oberamtstradition, doch keinen lokalen Konflikt breittreten! Sollten doch die hohen Herrschaften in Stuttgart entscheiden. Er zog den Bogen wieder ein, den er schon vor zwei Wochen begonnen hatte, tippte „Streng vertraulich“ darüber und setzte den Text fort: „Gleichzeitig wurde versucht, die Hirtenbriefe einzuziehen. In Binsdorf und Leinstetten ist dies gelungen, dagegen hat sich Stadtpfarrer Ginter in Sulz geweigert, den Hirtenbrief der Fuldaer Bischofskonferenz herauszugeben. Er hat diesen Hirtenbrief dann auch im Früh- und Hauptgottesdienst verlesen, trotz Anwesenheit des Polizeihauptwachtmeisters Ellgott.“ Genial, dachte er, notfalls drehe ich das so, dass der Ellgott den Ginter hätte daran hindern müssen. „Der katholische Pfarrer Throm in Leinstetten hat in der Predigt auf das Verbot lediglich hingewiesen, während Stadtpfarrer Konzet in Binsdorf in der Predigt überhaupt nichts erwähnte. Zu Kundgebungen der Bevölkerung ist es nirgends gekommen.“
6. Es kommt doch ans Licht der Sonnen!
Mittwoch, 9. November 1938, Gestapo-Leitstelle Mannheim, Sulz, Tübingen.
„Heut singt der Schweiger, wetten?“ Kriminaloberassistent Maler war sich ganz sicher. Das Wrack, das da von zwei Assistentenanwärtern mehr hereingetragen als -geführt wurde, war mal ein Postbote gewesen, mit Häuschen, Boot auf dem Neckar und Mitgliedsausweis der Sozialistischen Arbeiterpartei. Drei Wochen „Sonderbehandlung“ mit Einzelhaft, Stehzelle, Prügeln und endlosen Verhören hatte er standgehalten, aber wie Kriminaloberassistent Dieburg, der Verhörspezialist, zu sagen pflegte: „Hier wird jeder weichgekocht.“ Maler sagte kein Wort, saß nur da, den gespitzten Bleistift über dem schon getippten „Protokoll“ und sah auffordernd in das zerschlagene Gesicht seines Gegenübers. Nur eine Zeile war noch frei, da fehlte für den Tarnnamen „Wägele“ der Klarname. Was früher mal als Herr Schweiger zu erkennen gewesen war (was hatten sie da gelacht in der Zentrale), presste ihn jetzt durch die Zahnlücken: „Richard Schmid aus Sulz“. Der Maler hatte eine Art „Herr Schweiger“ zu sagen, dass einem vom bloßen Anhören schon speiübel wurde. „Abführen!“, bellte er jetzt nur und knallte einen Stempel auf das Papier: Überstellt KZ Flossenbürg.
Zwischen dem SA-Stab, dem Landratsamt, der Bürgermeisterei und dem Polizeiposten glühten die Telefondrähte. Zwei Tage nach dem Mord des Herschel Grynszpan am Legationssekretär vom Rath musste, wie im ganzen Reich, der spontane Volkszorn organisiert werden. Dabei sollte der Sulzer SA-Sturm in Haigerloch der Trauer und Wut Ausdruck verleihen.
Greifen wir der Zeit einmal acht Jahre voraus. In Tübingen, der Hauptstadt Württemberg-Hohenzollerns, tobte der Justizstaatssekretärstellvertreter Dr. Müller. „Was die Ausschreitungen gegen die Juden angeht, müssen unsere Staatsanwälte lernen, dass diese Akten beschleunigt bearbeitet werden. Stattdessen legen sie sie erstmal beiseite. Kein Wunder, die Angeklagten sind ihre Kumpane! Die Staatsanwaltschaft ist noch genauso naziverseucht wie die Polizei. Hier,“ sagte er zum Amtsgerichtsdirektor Nellmann, „lesen Sie mal, was unser eigenes Landeskriminalpolizeiamt da zusammenschmiert.“ Der Nellmann überflog das Papier stirnrunzelnd, dann las er laut, damit Landespolizeidirektor Härter es ebenfalls mitkriegte. „In den Mitternachtsstunden des 9. zum 10.11.1938 wurden Angehörige der Sulzer SA und Parteiangehörige alarmiert, da die Judenfrage gelöst werden sollte.“ Seine Stimme überschlug sich. „Die Judenfrage gelöst! Exakt so, wie sie es 1938 geschrieben hätten! Aber heute haben wir den 4. März 1947!“ „Den Mann, der das verbrochen hat, möchte ich morgen früh, 8:30 Uhr, in meinem Büro sehen“, sagte Dr. Müller zum Polizeidirektor. Nellmann las weiter: „Die alarmierte SA begab sich in Räuberzivil an den Sammelplatz, Wirtschaft „Zum Lamm“ in Sulz und erhielt durch den Sturmbannführer Hellstern aus Nordstetten den Befehl, nach Haigerloch zu fahren und dort die Judenfrage zu lösen. Etwa 25 bis 30 SA- und Parteiangehörige aus Sulz wurden in einem Omnibus nach Haigerloch befördert.“ „Weitere 20 quetschten sich“, sagte der Polizeidirektor, „in Privatwagen und fuhren mit. Ich hab‘ ihre Aussagen gelesen. Seit der Röhrle Politischer Kommissar ist, flutscht die Sache. Und wir haben vermutlich fast alle Namen. Eine ganze Reihe ist allerdings in Gefangenschaft oder eh schon im Gefängnis. Aber Sie glauben nicht, was die da alles erzählen. Fakt ist, dass sie um Mitternacht in die Wohnungen im Haag eingedrungen sind, die Familien terrorisiert und Gebäude verwüstet haben. Sie haben acht Männer willkürlich verhaftet und die Synagoge zerstört, Thorarollen geschändet, das Mobiliar herausgerissen.“ „Und, kann man die Täter benennen?“, fragte Dr. Müller. „Die meisten. Allerdings ist von den Juden keiner mehr da. Ausgewandert, verschleppt, viele nach Riga ins Ghetto, dann ins KZ Riga-Kaiserwald, schließlich umgebracht, was weiß ich. Über 100. Hier, das müssen Sie hören.“ Er zog ein weiteres Blatt aus der Mappe. „Gegen zwei Uhr nachts war ich damit befasst (er schreibt wirklich befasst!), Bücher aus einem Regal zu entnehmen (entnehmen!) und sie auf dem Boden umherzuwerfen. Und ein bisschen gebrüllt und dem Rabbi gedroht und geschlägert habe ich vielleicht auch. Der hatte sich ja mit seiner Familie hinterm Buchregal versteckt. In einem Geheimzimmer! Das klingt, als hätte er dabei gegrinst. Und der Vernehmungsbeamte auch? Andere sind im Viertel interessiert spazieren gegangen, weil sie es nicht kannten, nachts um zwei, haben Feuer gelöscht (gelöscht!), konnten aber wegen der Dunkelheit kaum irgendjemanden identifizieren. An den Misshandlungen hat sich keiner beteiligt und am nächsten Tag hat man darüber nicht mehr geredet, sich nicht mehr dafür interessiert. Deswegen können sie sich auch an Einzelheiten so schlecht erinnern. So, mein Nachbar war dabei? Sagt er das? Egal, da jeder ein bisschen was zugeben musste, haben sie sich gegenseitig genug belastet. Sind ja nicht die Hellsten. Und es existiert eine Namensliste. Sankt Bürokratius sei Dank. In Deutschland verkommt keine Akte. Die Busfahrt wurde abgerechnet. Alles zusammen sollte für 20 Verurteilungen langen. Sogar für ein paarmal Zuchthaus.“
7. Wo gehobelt wird
Dienstag, 3. Oktober 1939, Sulz, Stuttgart.
Auf dem Marktplatz war es so laut, dass man seine eigenen Gedanken nicht hören konnte. Seit dem Sieg über Polen läuteten jeden Mittag eine volle Stunde lang alle Glocken beider Kirchen. Karl Haas schloss das Fenster. Die Geste hatte etwas Symbolisches. Immer noch war er Redakteur, aber seine Zeitung hieß inzwischen Schwarzwälder Rundschau, und die meisten Texte brauchte er gar nicht selbst zu schreiben. Heute war eine Ausnahme, der Bericht über die Trauerfeier wurde nicht von der Zentrale vorgegeben. Richard Ehni, Dienstgrad Matrose, hatte die Ehre, die Reihe der Sulzer Gefallenen zu eröffnen, dachte der Haas. Da hatten sie also, was sie schon immer wollten. Macht euch schon mal ans neue Kriegerdenkmal, das wird ganz viel Platz brauchen. Der Dekan hatte ja in seiner Ansprache die Ansicht vertreten, der Matrose Ehni habe sein Leben für sein Volk gegeben. Auf der Westerplatte? Haas konnte sich nicht erinnern, dass jemand das von ihm verlangt hatte. Jetzt musste er so einen Mist drucken. Immerhin, er verkniff sich den Führer. Ja, der Haas hatte zu viel erlebt. Seine ursprüngliche Verachtung für die Dummköpfe war erst der Angst und dann dem Widerwillen vor ihnen gewichen. Aber dafür war es natürlich zu spät. Jetzt musste er sogar schreiben, was die SA auf der Feier getönt hatte: „Heimgegangen zur Standarte Horst Wessel!“
Die Glocken verstummten. Vor dem Rathaus hielt ein Wehrmachts-LKW, auf der Pritsche eine Gruppe polnischer Gefangener. Befehle gellten, die Männer wurden in die zugenagelten Arkaden getrieben. Ab Donnerstag sollte man sie mieten können. Bauern sollten dafür 1 RM, Firmen 3 RM pro Kopf und Tag bezahlen. Das könnte er ja auch schon gleich in die Zeitung setzen.
„Dem Schmid den Prozess in Stuttgart machen? Ausgeschlossen, der hat mir zu viele Freunde beim Oberlandesgericht! Bringen Sie ihn gefälligst vor den Volksgerichtshof!“ So hatte Richard Schmid aus einer halb geöffneten Türe brüllen hören, auf dem Weg zu einem weiteren Verhör im Hotel Silber, der Stuttgarter Gestapo-Zentrale. Anklage vor dem Volksgerichtshof! Jetzt hieß es, kühlen Kopf bewahren. Er musste wider Willen grinsen. In der Tat!
Der Krieg hatte auch Lina Leng die Treppe hinaufgeschubst. Nach dem Einrücken von Bestattungsmeister Ewald zur Wehrmacht, hatte diese sein Institut kurzerhand dem Lazarett im Krankenhaus zugeschlagen. Lina war jetzt offiziell Führerin der Pathologieverwaltung. In dieser Eigenschaft war ihr der Erlass des Reichsinnenministers Frick auf den Tisch geflattert. Unter dem Datum vom 18.8.1939, Az IVb 3088/39, ordnete dieser an, dass künftig „missgestaltete usw. Neugeborene“ den staatlichen Gesundheitsämtern zu melden seien. Das, wusste Lina, konnte nichts Gutes bedeuten. Allzu deutlich erinnerte sie sich noch an die unglaublichen Rechenaufgaben, mit denen man sie in der Schule bombardiert hatte. Wie viele gesunde Familien könnte man mit dem Geld unterstützen, das ein Geisteskranker oder Behinderter kostet? Sie griff zum Telefon, wählte die Nummer des Sekretariats. „Albert“, sagte sie, „komm mal runter, ich muss dir was zeigen.“ Denn auch wenn er sie, geschieden aber katholisch, nicht heiraten wollte, war er doch ihr Mann. Und hatte als Amtsbote im Krankenhaus unverdächtigen Zugang zu allen Räumen und allen Gerüchten. Nach unverdächtigem Zugang zu den Labyrinthen seines katholischen Gewissens hatte es sie nie verlangt.
8. Und es dreimal verachtet
Donnerstag, 4. April 1940, Grafeneck, Schweizer Grenze Schaffhausen – Erzingen, Warschau.
„Ach, das ist ja wunderhübsch!“ Die Schwester auf dem Beifahrersitz des grauen „Gemeinnützigen Krankentransport“-Busses blickte, anders als ihre Schäfchen, deren Fenster man mit Deckfarbe zu gepinselt hatte, durch das Tälchen hoch zum ehemaligen Jagdschloss Grafeneck. Straße, Schienen, Flüsschen, Telefonleitung, frisches Grün auf beiden Seiten, alles wie abgeschnitten von der hohen Mauer, auf welcher sich der Bau wuchtig und doch elegant erhob. „Wohl zum ersten Mal dabei?“, knurrte der Chauffeur. Dass sie um den eigentlichen Zweck dieser Fahrt nicht wusste, war schon gar zu unwahrscheinlich. Und das alles wunderhübsch zu finden, ging selbst dem abgebrühtesten Parteigenossen gegen den Strich. Hier wurde eine notwendige Operation am Volkskörper durchgeführt, klar, aber es war schwer, kein Mitleid zu empfinden. Oder doch nicht? Die Schwester half gerade der Liberata so freundlich und zärtlich aus dem Bus, als ginge es nicht ins „Kohlenoxydgas“ des Dr. Stähle, sondern ins Luxussanatorium.
„Stalin sei Dank!“ Ohne seinen widerlichen Räuberpakt mit Hitlerdeutschland, den Freundschaftsvertrag, hätten sie ihn sicher geköpft. Jetzt war gerade Schonzeit für Linke. Der subversive Rechtsanwalt Dr. Schmid kam mit drei Jahren Zuchthaus vergleichsweise glimpflich davon. Hatte doch die Gestapo mit allen Mitteln versucht, ihn der Vorbereitung zum Hochverrat im Ausland zu überführen. Aber der erfahrene Strafverteidiger hatte sie ausgebremst, war in keine Falle getappt. Jetzt saß er im Zug nach Ludwigsburg. Einer der Wärter hatte ihm eine Ausgabe der Schwarzwälder Rundschau zugesteckt. „Hier, mit Foto. Sie sind jetzt berühmt!“
200 km weiter süd-südwestlich traf den Rottwachtmeister Breinlinger aus demselben Grund schier der Schlag. Musste er jetzt Angst um seinen bequemen Posten haben? Er nahm sich vor, noch strenger zu kontrollieren und noch mehr auszuweisen. Wenn das mal kein Zigeuner war, der da vor ihm so arisch tat! So scheiterte der erste Versuch Anton Reinhardts, der Zwangssterilisation zu entkommen.
Das „festival filmowy“ hieß jetzt Saxonia, und eigentlich, dachte Leon Czech, war er ja inzwischen mit Dana quasi verlobt und hatte keinen Grund mehr gehabt, ins Kino zu gehen. Aber Sergej Eisensteins „Panzerkreuzer Potemkin“ konnte man auch durchgehen lassen. Unglaublich, welche Blüten die deutsch-sowjetische Waffenbrüderschaft trieb! Am Ausgang staute es sich. Deutsche Uniformen, Gebrüll, der dumpfe Aufprall von Schlagstöcken. Razzia! Alles, was jung und kräftig aussah, nach links. Dort standen mehrere Wehrmachts-LKW. Mit rüden Kommandos und Schlägen wurden die Ausgesonderten auf die Pritschen gejagt. Klappe zu, Plane runter. Stockdunkel war es hier drinnen. Wie die Zukunft als Zwangsarbeiter. Das wussten alle. Das machten die Besatzer so. Das war stadtbekannt. Und kein Geschrei und kein Jammern würden daran etwas ändern. Hört endlich auf zu heulen. Dana kann sich sicher zusammenreimen, was hier passiert. Aber dann?
9. Kollateralschäden
Sonntag, 22. Juni 1941, Molsheim, Sulz, Oberndorf.
Fast ein Jahr war es schon her, dass der große Traum des Hanns Trippel in Erfüllung gegangen und er in die SS übernommen worden war. Mit seiner SA-Karriere war er nie zufrieden gewesen, alles zu primitiv, und als Genie, Gourmet und Feingeist fühlte er sich im Bierdunst der ewigen Stammtische fehl am Platz. Mit was für Neanderthalern man da saufen musste! Es war gar nicht so leicht gewesen, selbst für den Erfinder und Produzenten des Wehrmacht-Schwimmwagens, in die heiligen Hallen der elitären Runenträger aufgenommen zu werden. Jetzt war er angekommen, trug die Sturmbannführerabzeichen Silber auf Schwarz und dennoch, und dennoch. Irgendetwas schwebte über seinem Haupt. Irgendetwas stimmte da nicht, irgendwer streute Sand ins Getriebe. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr schrieb er ans Personalhauptamt in Berlin und bat darum, ihm doch endlich den SS-Ausweis zu schicken. Die erforderlichen drei Passbilder hatte er im Januar eingereicht. Und immer noch keine Reaktion. Und jetzt auch noch dieses: Ein Kumpan im Reichssicherheitshauptamt hatte ihm geflüstert, dort sei die Rede von einer Untersuchung unrechtmäßiger Verwendung von Reichsmitteln. Das konnte alles bedeuten: von Büromöblierung bis zum heimlichen Aufkauf von Eisenschrott unter Umgehung des „Rüstungsprogramms B“. Trippel schaltete das Radio ein und war schnell getröstet: Seit heute früh stimmten die Fronten wieder, hatte die Wehrmacht doch mit über drei Millionen Soldaten die Sowjetunion überfallen. Seine Schwimmwagen würden dort, anders als in Frankreich, reißenden Absatz finden.
Die Lina hieß jetzt doch Braner, nachdem Alberts erste Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Ein Kind war unterwegs. So glücklich sie nun auch war, in ihrer Pathologie war sie es nicht. Sie wusste es nicht in allen Fällen, aber drei Kinderschicksale hatte sie dokumentieren können, mit Alberts Hilfe, der die Papiere im Schreibtisch von Dr. Schwarz gelesen hatte. Drei Säuglinge mit Missbildungen waren sofort nach der Geburt in Anstalten mit „Kinderfachabteilungen“ verlegt und innerhalb von vier Wochen getötet worden. Insgesamt hatte aber das Gesundheitsamt Sulz bis 1940 sieben Kinder, in diesem Jahr auch schon wieder fünf, in die „Erbkartei“ eingetragen und nach Berlin gemeldet. Was der „Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden“ schließlich verfügt hatte, war nicht herauszubringen. Selbst die Eltern wurden hingehalten und durften ihre Kinder in den „Heimen“ nicht sehen.
Dem Licht der Stablampen der Schweizer Wasserpolizisten war nicht mehr zu entkommen. Anton Reinhardts Versuch, die Schweiz dieses Mal schwimmend zu erreichen, war sozusagen ins Wasser gefallen. Sie zogen ihn an Bord. Sie halfen ihm an Bord. Niemand sagte viel, jeder tat, was er musste. Da war kein Hass, keine Beschimpfung. Sie fesselten ihn nicht einmal. Aber abschieben, zurück nach Deutschland, wo man ihn sterilisieren wollte – oder Schlimmeres antun – würden sie ihn eben auch. „Könnt ihr mich wenigstens an der Grenze zum Elsass ausschaffen?“
10. Tiefstehende Sonne bestrahlt schwarze Wolkenwand
Mittwoch, 24. Februar 1943, Sulz, Oberndorf, Dresden.
Unter dem dröhnenden Marschtritt der braunen Kohorten mischte sich misstöniges Sirenengeheul. Auf dem Stundenplan der Dritten Klasse der Oberschule stand nach Sport und Latein der für die Politische Schulung unerlässliche Film. Studienrat Haug zeigte einen weiteren Ausschnitt aus Leni Riefenstahls „Triumph des Willens“ über den Nürnberger Parteitag der NSDAP von 1934. Noch nie war ausgerechnet dieser Film ohne Unterbrechung vorgeführt worden. Und auch heute begaben sich Schüler und Lehrer in den Luftschutzbunker. Den Schülern war es Ehrensache, trotz aller Ermahnungen zu schlendern, nicht zu rennen. Noch nie war auf Sulz eine Bombe gefallen, und das gelegentliche MG-Feuer der Jagdflieger fürchteten sie nur auf offenem Feld.
Mira von Bern war schon immer eine leidenschaftliche Schwimmerin gewesen, trainierte eine Zeitlang sogar für die Schwimmstaffel des Gaus Württemberg-Hohenzollern. Wenn sie auch schon lange das Tanzen dem Martyrium des Trainings vorzog, wunderte sich doch kein Mensch, wenn sie, als Beschäftigte bei den Mauser-Werken, jede Woche ins Mauser-Hallenbad ging. In dessen Kesselraum ein gewisser Leon Czech, polnischer Zwangsarbeiter seines Zeichens, einer schweißtreibenden und rußigen Beschäftigung nachging. Wenn im Kesselraum Funken überspringen, ist das immer eine gefährliche Angelegenheit. Mira hätte, dank einer partiellen Glücksamnesie, gar nicht mehr sagen können, aus welchem Grund sie sich in den Keller verirrt hatte. Fakt war, dass die beiden ins Gespräch kamen, auf Englisch, und dass Mira, unter dem Vorwand, ihm ein paar dringend benötigte ausgemusterte Hemden ihrer Brüder zu bringen, wiederkam. Und einen toten Briefkasten ausbaldowert hatte, unter der Treppe zum Umkleidetrakt, um sich an ständig wechselnden Orten zu verabreden. Denn natürlich waren arisch-slawische Begegnungen nicht nur unerwünscht, sondern strengstens verboten; weitergehende Handlungen würden mit Erhängung (für ihn) und KZ-Einweisung (für sie) bestraft. Mira war keineswegs die Einzige, die sich in einen der attraktiven jungen Polen verliebt hatte. Und alle wunderten sich jeden Tag, dass sie nicht enttarnt, ihre geheimen Liebesnester nicht entdeckt wurden. Mira war freilich lange nicht bereit zu einer echten Beziehung. „Erzähl mir von Dana!“, war ihre bevorzugte Verteidigung, wenn der gegnerische Sturm zu nahe vor dem Tor aufkreuzte. Wie Leon es im Sommer schaffte, einen Ring mit blauem Glasstein aufzutreiben – von seiner Schwester, sagte er, aber die war doch in Warschau – blieb sein Geheimnis, tat aber seine Wirkung.
„Essen, Gautier! Und Bronislaus!“ Die beiden Zimmerleute zögerten. Was sollten sie jetzt tun? Als Kriegsgefangene aus dem Stammlager VC in Wildberg von der Wehrmacht auf den Brändehof ausgeliehen, unterlagen sie den rigorosen Gesetzen über den Umgang mit feindlichen und rassisch minderwertigen Arbeitskräften. Essen mit dem Arbeitgeber? Undenkbar. Aber da stand die Elsa Plocher mit ihrem freundlichen Gesicht über der BDM-Idealfigur und winkte die beiden in die Küche. Wo Bronislaw auf die Ecke zusteuerte, in der er seinen niedrigen Extratisch vermutete. Da stand aber keiner. Bronislaw hatte schon mal gehört, dass es auf einzelnen Bauernhöfen ganz anders zuging, als die arischen Goldfasane angeordnet hatten. Bei den Bilgers in Sigmarswangen musste sich der Bauer gelegentlich tagelang im Wald verstecken, weil die Nachbarn ihn angezeigt hatten, er behandele seine Polen, als ob sie Menschen wären. Und ob der Stefan, der es fast bis Warschau zurückgeschafft hatte, ohne Proviant vom Bilgerhof so weit gekommen wäre, durfte man auch bezweifeln. Genützt hatte es ihm freilich am Ende nicht. Aber sie hatten ihn zurückgebracht, nur halb verkrüppelt, und Bronislaw hatte ihn am Sonntag im Gottesdienst gesehen. „Setzt euch“, sagte die Bäuerin und wies auf den großen Tisch, wo zwischen den Kindern, der Magd, dem Knecht und der Stuttgarter Einquartierung noch zwei Teller standen. „Übrigens“, sagte ihr Mann, „ihr müsst nicht so schnell arbeiten. Ob das Scheunentor morgen oder am Montag fertig wird, ist egal. Aber so lange könnt ihr hier bleiben“. „Die Else will euch ein bisschen auffüttern“, sagte er noch und warf einen scheuen Blick auf die ausgemergelte Figur des Polen. „Und jetzt beten wir.“
Jedesmal, wenn er an der Guillotine auf dem Münchner Platz vorbeimusste, schauderte es den Nachrichten-Unteroffizier Karl Leng. Was für eine Art zu sterben! Und wozu? Auflehnung war so sinnlos. Die Ostfront wankte, aber sie war nicht durchbrochen. Im Sommer würde eine neue Offensive die Sowjets wieder zurücktreiben. Nicht einmal Stalingrad hatte den Militärputsch ausgelöst, der allein das System zum Einsturz hätte bringen können. Die Alliierten mochten noch so viele Flugblätter abwerfen, das deutsche Volk stand unbeirrt zu seinen Verführern. Leng erschrak, so etwas durfte man nicht einmal denken, wie leicht konnte man sich verplappern. In seiner Heimat am Oberen Neckar hatte die Gestapo einen fahrbaren Galgen in Betrieb genommen, hatte ihm die Schwester geschrieben. Leng konnte sich nie entscheiden, ob hängen schlimmer war als geköpft werden.
11. Näher, mein Krieg, zu dir
Dienstag, 1. August 1944, Sulz, Oberndorf.
„Was hängt ihr diese Fetzen raus, hängt doch lieber schwarze Fahnen heraus, zur Trauer für unsere Gefallenen!“ Der das auf der Straße laut sagte, war Ernst Keck, weshalb sich Obermeister Röhrle schon wieder mit dem Protokoll abmühen musste. Nun saß der Keck zum zweiten Mal im Gefängnis, in Horb, die Gestapo-Leitstelle schäumte Defaitismus, und Röhrle gab sich alle Mühe, ganz langsam zu tippen. Was er einfach nicht ins Protokoll schreiben konnte, war, was Keck ihm erzählt hatte: Der Älteste seines Freundes Wilhelm, der Fritz Leng, war jetzt auch gefallen. Was hieß hier gefallen? So sinnlos gestorben, da konnte kein Dekan mehr was hineingeheimnissen! Stabsunteroffizier Leng war zum Kompaniechef befohlen und wegen der verheerenden Offiziersverluste zum Zugführer ernannt worden. Warum aber starben so viele Offiziere? Weil sie sich nicht bücken wollten, wenn der Graben zu niedrig war, weil ihre Zigaretten in der Nacht glühten, weil sie ihre Gesichter nicht schwärzen wollten auf Patrouille, weil sie die Hände nicht von den Weibern lassen konnten. Sie machten es den russischen Scharfschützen einfach zu leicht. Und der Leng war stolz wie ein Spanier zu seinem Zug zurückmarschiert. Da machte es peng.
Jeden Morgen und jeden Abend wurden hunderte halbverhungerter Gestalten von SS und Gestapobeamten durch die Stadt getrieben. Die aus dem „Arbeitserziehungslager“ Aistaig für die Buntweberei hatten die kürzeste Strecke. Nur wenig länger führte der Weg vom Bitzelager in den ehemaligen Hallerdestollen zu den Firmen Kläger und Bosch. Weiterzugehen – und damit bessere Chancen, gelegentlich etwas zugesteckt zu bekommen – hatten die Gefangenen, Zwangsarbeiter und Häftlinge aus den Baracken am Friedhof, die in den Wäldern und den Steinbrüchen arbeiteten. Das galt auch für die Tübinger Gefangenen im Rathaus, die Holz für Luftschutzstollen schlagen sollten. Alle unterstanden der Wehrmacht, aber Erlasse regnete es auch aus dem Reichssicherheitshauptamt, der Württembergischen Forstdirektion und dem Amt des „Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz“. Streit über Zuständigkeit und Behandlung gab es dann noch zwischen der Stadtverwaltung und dem Forstamt am unteren Ende der Befehlskette. Je länger der Krieg dauerte, je mehr die Niederlage sich abzeichnete, umso chaotischer wurde das Management der Mangelwirtschaft und umso lückenhafter die Unterdrückung. Freilich wurde gerade diese Unterdrückung, wo sie zuschlug, immer brutaler. Das war es, was der Oberndorfer Stapostellenleiter Mußgay so hasste: nicht die Brutalität, sondern die Unordnung der Dinge. Mit Entsetzen registrierte er, das viele Bauern den erforderlichen Herrenstandpunkt vermissen ließen, dass andererseits die Zwangsarbeiter allein durch ihre große Zahl immer mehr außer Kontrolle gerieten, sich in Wäldern und in Scheunen trafen, politisierten, schäkerten und überhaupt guter Dinge waren, weil sie das Kriegsende kommen sahen. Da half nur noch der gehäufte Einsatz des mobilen Galgens.
Der Anruf kam unter diesen Bedingungen nicht unerwartet. Warschau war im Aufstand, die Rote Armee stand vor der Stadt, und in Köln war die Gestapo einer Widerstandsgruppe habhaft geworden, die Verbindungen nach Württemberg zu haben schien. Kriminalsekretär Paul Bässler, Spezialist für „verschärfte Vernehmungen“, hatte daraufhin „herausgefunden“, dass eine Zentrale des Widerstands aus bei den Mauserwerken beschäftigten Polen bestand. Kriminalkommissar Otto Schirmer war sehr erleichtert, musste er sich der Gefahr jetzt doch nicht allein stellen. Allerdings, sagte Mußgay Bässler in jenem Telefonat, sei das Dienstgebäude der Oberndorfer Außenstelle durch den Luftangriff vom 26. Juli so beschädigt worden, dass es für die Verhöre nicht zur Verfügung stünde. Er wisse aber, dass das alte Sulzer Gefängnis in der Bergstraße leer stehe. Er werde sich gleich darum kümmern. Und einen Dolmetscher habe er auch, Hugo Manitzki. „Also, wer sind die Scheißkerle, die ich verhaften soll?“
12. Tu spoczywaja w. Bogu (Hier ruhen in Gott)
Mittwoch, 2. August bis Dienstag, 3. Oktober 1944, Oberndorf, Sulz.
„Wohin“, sagte Leon Czech leicht genervt, „soll ich denn fliehen? Vielleicht lassen sie mich ja auch in Ruhe.“ Stanislaw Glabski war da ganz anderer Ansicht. „Auf jeden Fall solltest du dich eine Weile nicht, du weißt schon.“ Sie standen im Hof der Mauser-Werke, wo am Tag zuvor Verhaftete in Kompaniestärke angetreten waren. „Es ist doch nur eine Frage der Zeit. Die können sie doch gar nicht alle so schnell verhören.“ „Wenn du dich da mal nicht täuschst!“, sagte der Glabski. „Ich hab‘ dich immer gewarnt.“
Bässler benutzte in seinen Verhören drei Ochsenziemer. „Herrgott“, „Herr Jesus“ und „Gottesmutter“. Schon am Donnerstag meldete er der Hausverwalterin des Gefängnisses: „Es ist einer verreckt.“ Henryk Sudecki hatte als Ministrant vor der Schwarzen Madonna gekniet. Jetzt brach er unter den Hieben der „Gottesmutter“ zusammen. Amtsarzt Dr. Schwarz geriet in den nächsten Wochen von einer Peinlichkeit in die andere, er musste ja den ganz offensichtlich zu Tode Gefolterten einen ordentlichen Totenschein ausstellen. Jede Andeutung eines Zweifels wurde von Bässler korrigiert. So bescheinigte Dr. Schwarz dem Henryk Sudecki, er habe „sich rückwärts vom Bett fallen lassen, sodass es zu einem Genickbruch kam“. Bei Czeslaw Kudelski, den Bässler und Schirmer mit dem Kopf über einer glühenden Heizplatte aufgehängt totgepeitscht hatten, diagnostizierte er „Blutkreislaufschwäche“. „Die Schreie“, schrieb ein polnischer Arzt im Lager Brunnenbach, „waren in ganz Sulz zu hören.“ Und kamen nicht nur von Czeslaw Kudelski. „Gallenleiden“, „Herz- und Kreislaufschwäche“, „Blutvergiftung“, „Gehirnkrampf“, auch mal „Selbstmord durch Erhängen“. Dem guten Doktor Schwarz fiel immer noch was ein.
Stanislaus Pochopien hörte die Schreie auch monatelang, hielt sich aber im Lager Brunnenbach mehr schlecht als recht am Leben. Erstaunlich, was in so einem Löwenzahnblatt für ein Nährwert steckt! 30 Jahre war er jetzt alt geworden und hatte noch nie bei einer Frau gelegen. Galina, seine Sandkastenliebe, war, wie viele andere aus ihrem Dorf, auch in Sulz gelandet, wurde aber als Hausgehilfin in den Mauser-Werken eingesetzt. Ob sie da den Czeslaw kennengelernt hatte? Jedenfalls starben sie beide am gleichen Tag. Galina erhängte sich im Wald hinter dem Militärhospital.
Bässler und Schirmer konnten sich rühmen, eine große Verschwörung niedergeschlagen zu haben. Sabotage, Sprengung der Fabrik, Bau eines geheimen Radios, Pistolenschmuggel, Karabinerdiebstahl, Misshandlung von Deutschen, Planung eines Attentats auf Hitler. Alles hatten die Verhafteten, die jetzt neben dem Schindergraben außerhalb des Friedhofs verscharrt lagen, zugegeben.
Einer hatte nichts zugegeben. Leon Czech warf sich, bevor sie den Namen seiner „Rassenschande“ treibenden Freundin aus ihm herausfolterten, vor eine Lokomotive. „Nicht weinen! Nicht weinen! Wenn du dich jetzt verrätst, ist der Leon ganz umsonst gestorben.“ Mira von Bern konnte sich nicht mal krankmelden, musste alles unterlassen, was sie verdächtig machte. Sie wusste, dass die Spitzel von der Betriebszelle die jungen Frauen mit Argusaugen beobachteten. Nachts in ihrer Kammer wütete sie gegen einen Gott, der sie alle so im Stich ließ. Wie hatte der Herr Jesus gesagt? „Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde.“ Der hatte gut reden!
13. Letzte Reserven
Mittwoch, 4. April 1945, Sulz.
Von den fast zweitausend Menschen, die im Laufe des Krieges durch die verschiedenen Sulzer Lager gingen, war Dr. Mangille sicherlich derjenige, der sich hinterher am meisten schämte. Gerade hatte er, von der Arbeit an den V1-Leitwerken im Stollen zurückkommend, den Häftling Satory tot auf seiner Pritsche gefunden. Immer noch mussten die ausgemergelten Gefangenen des Bitzelagers 52 Wochenstunden in der unter die Erde verlegten Rüstungsproduktion malochen. SS-Sturmbannführer Hanns Trippel sorgte persönlich dafür, mal mit gezogener Pistole, mal mit einem selbst organisierten Zentner Griesbrei. Für August Satory kam der Griesbrei zu spät. Gestern Abend gab es nicht einmal Suppe, sondern nur Kartoffeln, drei für jeden Häftling. Mangille teilte Satory, der hoffnungslos darniederlag, nur zwei Kartoffeln zu, steckte die dritte in seine Tasche, was Satory aber bemerkte. „Gut“, sagte er, „ich brauche sie nicht, behalte sie nur selbst.“
„Elf Dosen Wurst! Ein ganzer Topf Schweineschmalz, schwarze Schuhe Größe 44!“ „Damen oder Herren?“, fragte Polizeimeister Engst und erntete einen vernichtenden Blick von der Schmiedemeistersehefrau Maria Fässle. „Zwei Äpfel hab‘ ich denen noch geschenkt!“ Die all das geklaut haben sollten, waren Soldaten der 3. Kompanie des Fliegerersatzbataillons VII aus dem Lager Forlewangen. Welche „mehrfach aus fadenscheinigen Gründen“ in ihrem Haus gewesen seien. Engst war skeptisch, ob der Diebstahl je aufgeklärt würde. Die Polizei hatte ganz andere Sorgen. In Wien pilgerten sowjetische Soldaten zum Grab von Beethoven, die Franzosen standen vor Karlsruhe, jede Nacht hörten sie in Sulz die Artillerie von der Westfront. Wenn man das noch eine Front nennen konnte. Stündlich war nun die Auflösung aller Lager zu erwarten, SS und letzte Wachmannschaften würden abrücken und die Sulzer mit Hunderten befreiter Zwangsarbeiter zurücklassen. Die würden sich doch rächen wollen!
Ähnliche Überlegungen, aber ganz andere Befürchtungen, plagten die Gefangenen. Würde man sie alle noch umbringen? In Gewaltmärschen ins Innere des Rest-Reiches treiben? Anton Reinhardt war erst im Sicherungslager Schirmeck gelandet, dann, nach dessen Auflösung, im KZ-Außenlager Haslach, anschließend über Dornhan ins Sicherungslager Sulz gekommen. Wo er nicht zu bleiben beabsichtigte. Er hatte sich mit dem Karlsruher Arzt Dr. Wolf angefreundet und die beiden hatten eine Idee entwickelt. Der Elsässer Gautier wollte nicht darauf warten, bis die SS entschied, was mit den Häftlingen geschehen sollte. Da gab er sich keinen Illusionen hin. Seit Tagen hagelte es Entlassungsrevers, nicht jedoch für die Politischen. Und auch nicht für Kriegsgefangene, weshalb er sich entschloss, den Ausbruch mit vier polnischen Kameraden zu wagen.
Reichsverteidigungskommissar! Der württembergische Gauleiter Wilhelm Murr warf sich in die Brust. Als Nachfolger des als „Oberbefehlshaber Oberrhein“ schmählich gescheiterten Heinrich Himmler! Allerdings, die Ernennung kam etwas spät. Egal. „Jeder“, diktierte er seiner Sekretärin im Kübelwagen an die Front in den Block, „der eine Panzersperre öffnet oder eine weiße Fahne hisst, wird gehängt. Seine Familie wird in Sippenhaft genommen.“ Murr plante mit Teilen der 719. Volksgrenadierdivision eine neue Verteidigungslinie aufzumachen; Freudenstadt war „bis zum letzten Mauerrest“ zu verteidigen, in Sulz, Fischingen, Mühlheim wurden Panzersperren errichtet, Häuser und Brücken gesprengt. Die Volkssturmmänner erhielten ihre Ausmarschbefehle, dieweil ihre Frauen die weißen Betttücher bereitlegten. Auf der Höhe des Wuhrs mühte sich das letzte Aufgebot von HJ, BDM, ältere Volksgenossen, gefangene Franzosen, um die Anlage eines Panzergrabens. SA-Scharführer Deinel wollte jeden niederknallen, der die Arbeit sabotierte. Speichel lief ihm aus dem Mund. Mittags gabs Eintopf für die Wachen. HJ, BDM und die alten Männer aßen ihre mitgebrachten Brote. Die Gefangenen tranken Neckarwasser aus einem Becher, den sie am Gürtel trugen, und aßen Löwenzahn und Sauerampfer. Die jungen Leute guckten dumm, die alten weg. Der Wetterbericht kündigte Schnee an. Aus dem Gefechtsstand in Glatten telefonierte Murr mit seinem Adjutanten: „Ihre Braut hat doch ein Modegeschäft? Das muss natürlich unter uns bleiben. Ich brauche einen Zivilanzug. Wir alle brauchen zivile Sachen.“
14. Über sein Herze ein Traum ging
Sonntag, 15. April 1945, Sulz.
„Plocher, du musst uns helfen!“ Drei Uhr in der Nacht vom 10. auf den 11. April. Gautier klopfte an die Fensterscheibe des Schlafzimmers auf dem Brändehof. „Um Gottes willen, seid leise!“ Plochers hatten immer noch eine Einquartierung. Eugen Plocher sah mit einem Blick, was los war. „Else, du bleibst hier. Ich bring‘ sie in die Scheune im Kachel.“ Zwei Stunden später kam er zurück. „Kannst du was kochen, solange es noch dunkel ist?“ Am nächsten Morgen war die SS da, mit einem Hund, aber die Spuren verloren sich in der nassen Wiese. Die Kinder waren strengstens instruiert. Magd und Knecht fühlten sich als Teil der Familie. Die Ausgebombte aus Stuttgart konnte die Geräusche, die ein Bauernhof machte, nicht deuten. Womöglich war es üblich, nachts mit dem Henkelmann Essen abzuholen? Wenn bloß die Franzosen schnell machten!
Am Donnerstag war die SS abgerückt und hatte die gehfähigen Häftlinge mitgenommen. Trippel und eine Handvoll notdienstverpflichteter Wachleute versuchten, den Betrieb im Stollen aufrechtzuerhalten. Bei den alten Herrschaften von der Wache hatte es zu vollständigen Uniformen nicht mehr gereicht. Nachts um zwei war eine gute Zeit, das Lager zu verlassen. Reinhardt und Dr. Wolf machten sich zu Fuß auf den Weg. Wolf trug Wehrmachtsmantel und -mütze und hatte offensichtlich den Auftrag, einen Verhafteten zu überstellen. Sie kamen bis Bad Rippoldsau, wo sie in eine Übung des Volkssturms gerieten, die Forstrat und SS-Ordensträger Karl Hauger leitete. Wegen „Feigheit vor dem Feind“ lief gerade ein Gaugerichtsverfahren gegen ihn. Hauger übergab Wolf der Feldgendarmerie, Anton Reinhardt musste sich sein Grab schaufeln und wurde nach einer Standgerichts-Farce von Hauger erschossen. An seine Mutter hatte er noch geschrieben: „Meine liebe Mutter, ich will euch meinen letzten Wunsch mitteilen, da ich euch nicht mehr sehen werde, wünsche ich euch eine gute Gesundheit und ein langes Leben. Gute Nacht!“
Andere hatten Glück. Der Gefangene Graf und ein Leidensgenosse erhielten einen Marschbefehl „Richtung Bodensee“. Auf einem Handwägelchen sollten sie den Koffer des sie begleitenden „Wachmanns“ ziehen. Welcher sie prompt in einem Waldstück zum Austreten schickte. Jetzt galt es noch, sich zu verstecken, bis die Franzosen kamen.
15. Auf Messers Schneide zur Befreiung
Donnerstag, 19. April 1945, Sulz.
Den Wunsch nach schneller Ankunft der Franzosen hegten auch andere. Ernst Keck war schon seit zwei Tagen befreit, konnte aber nicht nach Hause, weil die Front irgendwo zwischen Horb und Sulz verlief. Nur durften die Truppen auf keinen Widerstand treffen, sonst würde Sulz so zerstört werden wie Freudenstadt. Andererseits tauchten immer wieder kleinere Einheiten SS und Militär in der Stadt auf und drohten, jeden „Defaitisten“ aufzuhängen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten Eugen Plocher vom Brändehof und Eugen Ruoff aus der Holzhauserstraße dann dennoch die Stämme der Panzersperre auf Höhe des Steinbruchs in der Glatter Straße abgesägt. Andere Bürger taten es ihnen in der Oberndorfer Straße und der Langensteige gleich. Den Lärm, den sie in stiller Nacht zwangsläufig dabei verursachten und der sie das Leben kosten konnte, nahmen sie in Kauf. Nicht, dass man sie später einmal dafür besonders ehren würde!
In den letzten Tagen war die Bevölkerungsdichte auf dem Brändehof noch angewachsen. Polinnen und ein Jugoslawe waren, ganz offen, dazugekommen. Else Plocher, im neunten Monat, kam vom Herd nicht mehr weg. Und während Reichsverteidigungskommissar Murr seinen Befehlsstand auf die Alb bei Schelklingen verlegte, den Zivilanzug immer griffbereit, während also Stuttgart nicht bis zum letzten Mann verteidigt wurde, standen sie in der Einfahrt des Brändehofs angetreten unter einer Trikolore, die sie genäht hatten, und begrüßten die französischen Befreier, noch bevor diese in Höhe Steinbruch auf Dr. Kohler trafen, der die Stadt übergab.
Am Abend klopfte es an die Tür des Brändehofs. Ein Soldat brachte das Kaninchen zurück, das seine Einheit requiriert hatte.
Epilog
Freitag, 23. Juli 1948, Sulz
Vor elf Jahren war ich schon mal hier, erinnerte sich Albert Braner, als der Zug auf dem Bahnhof zum Stehen kam. Aber dieses Mal … und da sah er sie schon. Lina, mit der kleinen Anna an der Hand, und der schlaksige Junge, das musste das polnische Waisenkind sein, der Aleksander, von dem sie ihm in sein „Bergwerkskommando“ in Saint-Laurent-d’Andenay geschrieben hatte. Und hatte der heute nicht sogar Geburtstag? „Stimmt“, sagte die Lina eine ganze Weile später. „Und ab nächster Woche wechselt er in die Volksschule.“ Und da der Albert nur Bahnhof verstand, erklärte sie, wie sie mitgeholfen hatte, im Evangelischen Gemeindehaus eine Schule für die Kinder der Zwangsarbeiter einzurichten. „Viele können ja gar nicht zurück, Russen wollen sie nicht werden. Aber jetzt“, sagte sie und hob zwischen Daumen und Zeigefinger ein funkelnagelneues Markstück in die Höhe, „gehen wir ein Eis essen.“
Wir (der Autor Klaus Schätzle und der Förderverein e.V. Kulturhaus Gustav Bauernfeind) bedanken uns an dieser Stelle für Ihr ausdauerndes Interesse an unserem lokalgeschichtlichen Fortsetzungsroman!

Autor:
Klaus Schätzle, geb. 1948
Lokalhistoriker mit ausgeprägter Schwäche für „Geschichte von unten“.
Kapitel 5: Verfolgung und Widerstand
Autor:

Klaus Schätzle, geb. 1948
Lokalhistoriker mit ausgeprägter Schwäche für „Geschichte von unten“.
 In Sulz kann das Buch in der „Blass Erlebniswelt im Backsteinbau GmbH“ und bei der „Buchlese“ am Marktplatz erworben werden.
Erschienen ist das Werk im Verrai Verlag / Stuttgart mit der
ISBN 13: 978-3-948342-72-2.
In Sulz kann das Buch in der „Blass Erlebniswelt im Backsteinbau GmbH“ und bei der „Buchlese“ am Marktplatz erworben werden.
Erschienen ist das Werk im Verrai Verlag / Stuttgart mit der
ISBN 13: 978-3-948342-72-2. 