Raum für Aktionen, Menschen und Ideen

Ausstellungen
I am text block. Click edit button to change this text.

Konzerte
I am text block. Click edit button to change this text.

Lesungen
I am text block. Click edit button to change this text.

Kleinkunst
I am text block. Click edit button to change this text.

Seminare
I am text block. Click edit button to change this text.

Galerie
I am text block. Click edit button to change this text.
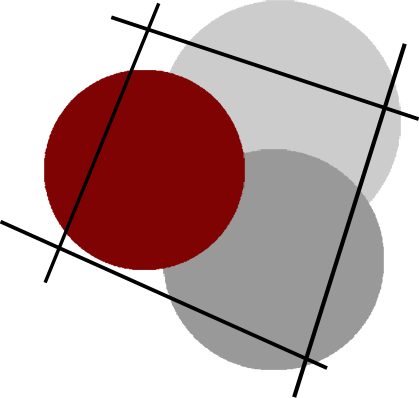
11. September 2021
1. Sulzer Kulturtag
EntdEcken
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
zeigen
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Staunen
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Unter dem Gähnenden Stein
(Sulz 1848–1948)
Kapitel 1: Revolution

Fahne der Sulzer Bürgerwehr, Bauernfeind Museum Sulz
Foto: Ulrike Steinbrenner
1. Zehn Uhr: Revolution!
Sulz, Dienstag, 26. September 1848, 22:00 Uhr.
Genau über dem Treppenaufgang zum „Schwanen“ war schon seit Monaten ein großes Loch in der Traufe und konzentriertes Regenwasser hatte einen beachtlichen Graben vor der ersten Stufe ausgeschwemmt. Der Oberförster Kuno von Uexküll-Gyllenband, nach drei Maß Bier, stieg also vorsichtig, vorsichtig (!) auf den an dieser Stelle stockdunklen Marktplatz hinunter. Die Zeiten waren schlecht, also würden Traufe, Loch und Dunkelheit noch eine ganze Weile so bleiben. Aber es gibt welche, die sind wirklich schlimm dran, dachte Kuno. Schließlich hatte er vor einem Jahr die Bürgerwehr gegründet, weil all die Vaganten, Diebe und Arbeitslosen den Sulzern Angst machten. Und jetzt hatte er selbst Angst, der Herr Kommandant!
Er ging hinüber zur Viehtränke. Typisch, ich genau dazwischen, schoss es ihm durch den Kopf. Rechterhand im Rathaus brannte Licht, im Oberamt links war alles dunkel. Der Oberamtmann Herbort schlief sicher den Schlaf des Gerechten. Aber nein, er musste es doch auch schon gehört haben. Vielleicht stand er sogar hinterm Fenster, wie vor ein paar Monaten, am 22. März, als der Pöbel ihm die Scheiben einwarf und er sich nicht nach draußen traute, um die Ordnung wiederherzustellen. Ja, nicht einmal den Landjäger oder den Ausscheller hatte er benachrichtigt, als Uexküll-Gyllenband ihn in seiner Wohnung aufsuchte. Kuno musste die Krakeeler allein besänftigen.
Und wer war noch im Rathaus? Vermutlich der Skribent Mühlhäuser, der arbeitete an einer neuen Proklamation! Oder doch sein Chef, Stadtschultheiß Pfäfflin? Seit dem Frühjahr war das Rathaus das Hauptquartier der Demokraten, außerhalb der Stammtischzeiten wenigstens. Und die Sulzer Bürger hatten sich mit ganzer Kraft, wie es schien, der Revolution hingegeben. Hatten Petitionen verfasst und unterschrieben, was sehr mutig war; hatten sich an den Wahlen beteiligt, sich heiser diskutiert, Volksversammlungen und Märsche absolviert, Freiheit, Arbeit und eine neue Verfassung verlangt, sowie die Abschaffung geistlicher, adliger und militärischer Privilegien.
Der Oberamtmann, überwältigt vom Elan der Revolution, wusste nicht, wo ihm der Kopf stand: mal lief er mit Heckerhut den Radikalen hinterher, mal zeigte er sie bei der Kreisregierung an.
Und heute hängt schon wieder alles an mir, dachte Kuno. Seit einer halben Stunde wusste er, dass sich etwa 300 bewaffnete Revolutionäre, in der Mehrzahl aus Schramberg und Oberndorf, auf dem Weg nach Sulz befanden. Nach dem Vorbild der zweiten badischen Revolution wollten sie in Stuttgart endlich Nägel mit Köpfen machen.
Sie seien unter allen Umständen aufzuhalten, sagte die Regierung.
Sollte der Oberförster Uexküll-Gyllenband seine Bürgerwehr gegen die Revolutionäre stellen? Dumm nur, dass viele von ihnen auch bei der Bürgerwehr waren und sie 150 Gewehre führten, dazu Sensen, umgedengelt zu Lanzen, und Mistgabeln! Die Sulzer waren eine eher behäbige Truppe, alles andere als furchteinflößend. Aufhalten könnten sie keinen Vereinsausflug, geschweige denn die Herren Held, Moser, Jegglin. Was für eine Blamage! Noch hatte die Revolution in Sulz niemandem das Leben gekostet. Aber Befehlsverweigerung war ein Kapitalvergehen. Bis heute hat Herbort meine Wahl zum Bürgerwehrkommandanten nicht gegengezeichnet, dachte Kuno grimmig, und jetzt soll ich für ihn die Kastanien aus dem Feuer holen?
Was würde der Oberförster tun?
2. Vor Gericht
Ein Jahr später, Ludwigsburg, Donnerstag, 27. September 1849.
„Diese verflixte Sulzer Bagage!“, schimpfte der Gerichtsgehilfe Schlothbeck. „Jetzt zeigen die sich gegenseitig an, damit alles noch verworrener wird!“ „Zeig‘ mal her“, sagte der Oberskribent Tannbaur. Er las die Anzeige des Oberamtmanns Herbort gegen den Oberförster Uexküll-Gyllenband mit einem gewissen professionellen Wohlgefallen. „Kompliment, die Herren Streithähne! Die wissen genau, je mehr Steine sie ins Wasser schmeißen, desto trüber wird es.“ „Und die Schöffen werden wieder sagen, da war doch nix, die haben doch nur versucht, die Leute zu bändigen“, piepste der Schlothbeck, der immer ganz rasch erfasste, aus welcher Richtung der Wind wehte. „Ja, die Schöffen! Die Revolution ist vorbei, aber die Schöffen, die gibt’s immer noch, und es hagelt Freisprüche. Aber Befehlsverweigerung! Bin gespannt, wie er das morgen wegerklärt, der Uexküll mit drei Ü.“
„Unter uns, ich hab‘ mir den Uexküll heute mal vorgeknöpft“, sagte der Richter Armbruster und drehte sein Viertele Schlachthäuser Trollinger kennerhaft zur Kerze, welche das Blutrot so recht zur Geltung brachte. „Werd‘ aber nicht schlau aus ihm. Ab in die Schellen.“
„Was ist denn da so schwer zu verstehen? Der Herbort hat ihn angezeigt wegen Feigheit, und das triffts! Durch!“ Der Pastor Schubbig ließ sich auch am Honoratiorenstammtisch von keinem an Königstreue übertreffen. Auch nicht beim Binokel. „Aber Sie wissen ja nur die Hälfte“, begann der Armbruster, wurde aber von Apotheker Bäuerkes „Her mit der Sau!“ jäh unterbrochen. „Spielen wir oder politisieren wir?“ Sie spielten.
Zwölf Stunden später war Richter Armbruster leicht verkatert und immer noch nicht schlauer. Der Oberförster Uexküll-Gyllenband stand kerzengerade in seiner Uniform, die Bandschnalle des „Ordens der Württembergischen Krone“ dezent, aber unübersehbar, über der rechten Brusttasche. Den als Staatsanwalt agierenden Justizadjunkt beachtete er gar nicht, sprach nur zu den Schöffen. „Ich musste ja auf alle Fälle ein Blutbad vermeiden. Die Sulzer Bürgerwehr durfte erst gar nicht ausrücken. Wäre sie ausgerückt, hätte sie sich 300 Gewehren gegenübergesehen. Und hätte sie sich ergeben, was hätten die Leute gelacht! Also: auf keinen Fall ausrücken.“
„Ach, deshalb sind Sie…“, Armbruster ging ein Licht auf. Uexküll-Gyllenband nickte. „Der Zufall hat mir geholfen. Als ich so an der Viehtränke stand und grübelte, kam die Nachtpost angerasselt. Natürlich, der Nachtpostwagen nach Stuttgart! Wenn der Kommandant nicht da ist … also stieg ich ein. Nicht mal meiner Schwiegermutter konnte ich Bescheid sagen. Kein Kommandant, kein Zusammenrufen der Bürgerwehr, keine Befehlsverweigerung, kein Ausmarsch, keine Blamage, kein Blutvergießen“. „Aber ihr, euer eigenes Ansehen“, warf der Richter ein. „Hat gelitten,“ sagte der Oberförster trocken und schaute zur Schöffenbank.
3. Cäsars Köche
Sulz, Dienstag, 26. September 1848, 22:30 Uhr.
Schon von weitem hatte er sie singen hören: „Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker.“ „Ihr könnt’s wohl nicht erwarten“, knurrte der Oberamtmann Herbort hinter seinem Schlafzimmervorhang. Da kamen sie in Reih und Glied, die Herren Revolutionäre aus Schramberg, Dunningen, Winzeln und Oberndorf. Nachts um halb elf, das ist Ruhestörung, dachte Herbort automatisch, wo bleibt der Uexküll? Wo steckt überhaupt die Bürgerwehr? „Ich denk‘, was ich will“, dröhnte es trotzig herauf, „und was mich beglücket; doch alles in der Still“, da kam das „Kompanie: Halt!“, des Anführers. Sapperment, der Jegglin! Natürlich! Der Jegglin war alles, was der Oberamtmann nicht war: ein Mordstrumm Mann, geborener Anführer, demokratisch gewählt, trinkfest, beliebt bei den Leuten und eine Schwertgosch; Wirt des „Schützen“ dazu. Herbort wusste nicht, ob er sie bewundern sollte oder hassen: den Jegglin und den Förstergrafen.
Offensichtlich war alles gut organisiert. Auf dem Brunnentrog stand der Apotheker Johann Baptist Bauernfeind und dirigierte. So wie der wieder aussieht, würde kein Mensch von ihm eine gebrauchte Kutsche kaufen!, dachte der Spion hinterm Fenster. Neben ihm, unter der Lampe, der dürre Mühlhäuser, mit Papieren fuchtelnd. Und, Herbort traute seinen Augen nicht, eine Menge Sulzer, welche die Marschierer bei sich einquartieren wollten.
Vor dem „Ochsen“ am Rande des Marktplatzes, stand Konstantin Schäller und wollte gerne mitmachen. Schon im März war er bei jeder Volksversammlung dabei gewesen, und er hätte die nachgerade berühmte Sulzer Petition auch unterschrieben, wenn er denn hätte schreiben können. Der „Konde“, wie sie ihn hier nannten, konnte aber nicht schreiben. Er hatte mit 13 als Pferdeknecht im Dienst eines russischen Fähnrichs seine ostpreußische Heimat verlassen und war nach dessen unrühmlichem Tod einfach in Sulz geblieben. Der frisch beförderte Oberfähnrich hatte im Suff ein Bad im Neckar nehmen wollen und, wie so viele jedes Jahr, das „Flüsschen“ sträflich unterschätzt. Jetzt betrieb der Konde ein Fuhrgeschäft, aber nach erst dreißig Jahren in einem winzigen Häuschen in der Vorstadt lebend und mit einem „Bankert“, war er keineswegs respektabel eingebürgert. Den „Bankert“ hatte seine Magdalena in die Ehe gebracht, den Benefiz Bippus. Der Pfarrer hatte die Stirn gerunzelt, gab sich aber zufrieden, als die Magda ihm erklärte, sein Großvater habe Bonifaz geheißen, sei aber immer Benefiz gerufen worden. Der Konde und die Magda waren gut zueinander gewesen. „Alle Jahr ein Kind, bis es fünfundzwanzig sind“, hatten sie bei der Hochzeit gesungen. Aber die Magda hatte sich nicht an die Abmachung gehalten und war nach dem siebten gestorben. Er hatte nicht mehr heiraten wollen. Manchmal ging er zur Witwe Bollinger.
Als es 11 schlug, standen nur noch wenige Bürger zur Aufnahme bereit, und als der Name des Reallehrers Lang vom Mühlhäuser verlesen wurde, meldete sich der Konde dann doch. Der Mühlhäuser zögerte einen Moment und sah zum Bauernfeind hinüber; der zuckte mit den Achseln: Wir sind jetzt alle Demokraten, sollte das wohl heißen. Der Mühlhäuser nickte und trug in die Liste ein, der Lang schulterte Gewehr und Rucksack und verschwand mit dem Konde in der Nacht.
4. Lauter Strategen
Mittwoch, 27. September 1848 , kurz nach Mitternacht.
„Wir Schramberger,“ sagte der Lang eher beiläufig, „meinen inzwischen, dass wir keinen König mehr brauchen. Wie seht ihr das in Sulz?“ Auf eine Antwort wartete er erst gar nicht, der Schäller hätte sie auch nicht gewusst. „Was wir in Württemberg jetzt tun müssen ist, die Badener nicht im Stich zu lassen. Württembergische Soldaten in Freiburg, das darf nicht wieder passieren! Wir müssen den König so beschäftigen, dass er nicht mal dran denken kann.“ „Wie sieht’s denn aus in Baden?“ Der Schäller war ganz verschüchtert von so viel strategischem Durchblick. Sie standen auf der Neckarbrücke. „Der Großherzog iss woter anderte bridsch!“, sagte der Lang, der aus Göttingen kam, wo er bei Rasmus Christian Rask zwei Semester Anglistik studiert hatte, als der Kurfürst ihn wegen „politischer Umtriebe“ des Landes verweisen ließ.
„Habt ihr mitgekriegt, was in Frankfurt passiert ist?“, fragte er jetzt, und der Konde, der immer noch daran kaute, mit wem der badische Großherzog Karten spielte und warum das wichtig war, musste passen. „Dass wir eine provisorische Regierung gewählt haben, wisst ihr aber schon? Den Erzherzog Johann! Den Bruder des Kaisers! Als Chef der Revolutionsregierung! Was für ein Hohn! Und dass der österreichisches und preußisches Militär gegen unsere eigenen Leute eingesetzt hat?“ Der Konde nickte. Einerseits. Er konnte sich gut an die Wahl zur Nationalversammlung erinnern, war er doch, sehr zu seiner Überraschung als Wähler zugelassen. Und an die Hoffnungen auf einen neuen, besseren Staat, und wie sie sich rasch abnutzten, weil die Abgeordneten in der Frankfurter Paulskirche so sehr uneins waren. Schon dass der Sulzer Schultes Pfäfflin im Wahlkreis einem Stuttgarter Professor unterlag, war enttäuschend, auch wenn der Christian Frisch sich bei den „Linken“ einreihte. Aber was der Lang ihm jetzt geradezu entgegenschleuderte, war ihm neu: Der „Reichsverfauler“, pardon, Reichsverweser, der Erzherzog, ließ auf Demokraten schießen. Weshalb in Lörrach ein gewisser Gustav Struve die „Deutsche Republik“ (weg mit dem Fürstengesindel) ausgerufen und 5.000 Bewaffnete ausgeschickt habe und zu seiner Unterstützung der Fabrikant Rau in Rottweil und der Advokat Würth in Sigmaringen ebenfalls Tausende Freischärler losgelassen hätten. Der Lang redete sich richtig in Rausch: „Versteht ihr, Schäller, wir kommen den Fürstenknechten von drei Seiten!“
Von der Straßenseite kam Pferdegetrappel. Ein reitender Bote tauchte kurz im Lichtkegel auf und verschwand Richtung Marktplatz. Hatte er gestutzt, weil er den Lang erkannte?
Im Rathaus war immer noch Licht. Der Skribent Mühlhäuser schwamm auf der Welle seines Erfolgs. Erst hatte er am Abend im „Schwanen“ die eiligst einberufene Bürgerversammlung geleitet und, seinen Zweifel und seine Schüchternheit über Bord werfend, alles auf die Karte der Revolution gesetzt. Dank seiner Beredsamkeit hatte die Versammlung den Beschluss gefasst, alle wehrfähigen 20- bis 40-Jährigen sollten mit den Schrambergern losziehen. Selbst der Kommandant der Bürgerwehr, Graf von Uexküll-Gyllenband, hatte die Hand gehoben. Dann allerdings war er rasch verschwunden.
Jetzt saß der Mühlhäuser über der Namensliste, und ihm wurde klar, dass da noch zwei Dinge fehlten. Erstens mussten die Dörfer mitmachen und zweitens drohte er jetzt mit einem vollen Gulden Strafe bei Nichterscheinen. Schnell schrieb er noch den Wortlaut seines Erlasses zehn Mal ab; er sollte in aller Herrgottsfrühe auf den Dörfern ausgeschellt werden. Ja, Bürgermeisterstellvertreter, das hatte was! Danke, Herr Pfäfflin! Der Mühlhauser reckte sich und trat ans Fenster. Nanu, Licht beim Oberfaulpelz gegenüber?
Wo sind Jegglin und seine Leute untergebracht, in der „Sonne“?“, fragte der Oberamtmann Herbort den Ausscheller Spellenbeck. „Ich muss ihn dringend sprechen. Und sorgt dafür, dass der Mann wo schlafen kann!“ Er nickte dem Boten zu. „Ich hab’s immer gewusst.“ Zu Spellenbeck: „Geh’n wir also in die „Sonne“. Hoffentlich schlafen die noch nicht.“
In Waldmössingen ließ um diese Zeit der Schramberger Mohrenwirt Grüninger sein Pferd tüchtig saufen; auch er wollte zum Jegglin nach Sulz. Und im Sigmaringer Schloss brannten Kerzen in allen Räumen und Gängen. Fürst Karl Anton, seit einem Monat im Amt, trieb die Dienerschaft an: „Schnell, schnell, wir müssen hier weg! Nur das Notwendigste einpacken!“
Gasthof „Sonne“, 5 Uhr am Morgen. „Grüninger, das wissen wir schon lange!“ Auf dem Flur im ersten Stock der „Sonne“ war die ganze revolutionäre Prominenz versammelt, im geliehenen Nachthemd zwar, aber voll handlungsfähig: der Delegierte aus Straßburg, Kaufmann Moser, Carl Elias Held von der berittenen Rottweiler Bürgerwehr und der Befehlshaber Anton Jegglin. „Struve ist geschlagen, na und? Das hat uns der Herbort vor vier Stunden auch schon erzählt. Aber wir sind es nicht. Und der Würth auch nicht. Badische Truppen kommen nicht hierher. Die württembergischen sind nicht mal alarmiert. Warum sollten wir also aufgeben? Wir haben den Herbort weggeschickt, wir können nicht sagen, es tut uns leid, wir haben’s uns anders überlegt.“
„Wir sind doch keine Memmen! Ich hab’…“, Carl Elias Held brach mitten im Satz ab. Ob das der geeignete Moment war zu sagen, dass er von der Niederlage der Struveschen Truppen schon gewusst hatte, als er die Beffendorfer noch zur Teilnahme an der Revolution antrieb?
Von all dem wusste der Mühlhäuser nichts. Eine Stunde später las er vor versammelter Bürgerschaft auf dem Marktplatz die Erklärung des Fabrikanten Rau vom 25. September vor: „Die Volkssouveränität ist hiermit feierlich ausgesprochen. Mit Gott für das Volk!“ Und schloss: „Es lebe die Revolution! Auf nach Stuttgart!“
Der Auszug verzögerte sich etwas. Zu Recht wandten die anwesenden Zwangsverpflichteten ein, dass sie erst noch zuhause Ausrüstung und Verpflegung fassen und sich von der Familie verabschieden wollten. Was alles die Allermeisten von ihnen gänzlich unterließen. Die Herren Jegglin, Moser und Held bauten sich inzwischen im Amtszimmer des Behördenchefs auf und verkündeten die neue Parteilinie: „Wir ziehen nach Stuttgart, um unseren bisher unerhört gebliebenen Wünschen Nachdruck zu verleihen. Wir werden vorher fragen, ob wir mit Waffen in Stuttgart einziehen dürfen. Wenn nicht, werden wir die Waffen in einem Dorf vor der Residenz zurücklassen. Wir werden aber auf keinen Fall umkehren.“ Aha, dachte der Herbort, verzog aber keine Miene, sie merken, sie haben sich verzockt.
Der Schäller und der Lang waren beim Abmarsch auch dabei, wenn auch in durchaus verschiedenen Eigenschaften. Der Lang als Unterleutnant, der Schäller als bezahlter Dienstleister, der Fußkranke aufnehmen und Waffen und Verpflegung transportieren sollte. „Ich weiß nicht, wann ich zurück bin,“ hatte er sich von Benefiz verabschiedet. „Das kann ein paar Tage dauern.“
Aber noch am selben Abend stellte er die beiden Braunen wieder in seinen Stall.
5. Tapfer ist der Besonnene, der Tollkühne ist nur tollkühn
Mittwoch, 27. September 1848 , Müllheim, Sigmaringen, Balingen, Sulz- Mühlheim, Sulz
Aus der Vogelperspektive betrachtet, stellte sich die Lage am frühen Morgen des 27. September 1848 so dar: Gustav Struve, der Anführer des zweiten badischen Aufstands vom 21. September, seine Frau Amalie und einige Freunde saßen in Müllheim in Haft, bis auf Amalie alle in Ketten. Am 23. war über den Südschwarzwald das Standrecht verhängt worden; Struve musste mit seiner und seiner Freunde sofortigen Erschießung rechnen. Seine Freiheitskämpfer hatten sich die roten Bänder vom Arm gerissen und waren in heller Flucht begriffen, viele auf dem Weg in die Schweiz, dem traditionellen Unterschlupf der deutschen Revolutionäre.
Fürst Karl Anton war sich nicht sicher, worüber er mehr Verbitterung empfand: dass er gezwungen war, aus Hohenzollern-Sigmaringen nach Überlingen zu fliehen oder über das Scheitern seiner Verhandlungen mit der provisorischen Regierung in Frankfurt. Hatte er doch angeboten, auf alle Souveränitätsrechte zu verzichten! Ohne dass Tausende Bauern ihm mit Knütteln kamen, wie in Hechingen. Jetzt sollten ihn seine Sigmaringer kennenlernen! Er würde wiederkommen – mit Soldaten. Aus Bayern! Oder Preußen, egal! Karl Würth, du Schlange, das Grinsen wird dir noch vergehen!
Dem Würth war aber keineswegs nach Grinsen zumute: Er fand einfach keine Leute, die bereit waren, die Regierungsgewalt auszuüben. Der Sigmaringer Turnverein hatte das Militär entwaffnet, seine Leute beherrschten die Straße, mobilisierten leicht 10.000 Demonstranten, aber eigentlich wollten sie die Französische Revolution gar nicht kopieren. Lieber erst mal nix tun. Nicht zu radikal werden! Geht heim, Leute, Heu ernten!
Der Fabrikant Gottlieb Rau war auf einmal ein Häuptling ohne Indianer. Acht Uhr, Antritt der Balinger und Rottweiler Bürgerwehren und Freiheitskämpfer, so war es geplant. Nur, die Niederlage Struves hatte sich herumgesprochen, und so wollten die Rottweiler nur noch eines: nach Hause. Und kein Rau konnte sie aufhalten. Der hatte ja noch in der Nacht von „dunklen Gerüchten“ gefaselt. Fake news verbreitet, eben. Von den Balingern war erst gar keiner am Sammelplatz erschienen. Was tun? Rau nahm die Kutsche nach Sulz. Dort wollte er sich an die Spitze des Zuges setzen.
Der war indes schon abgefahren. „Wann werden die Malefizer endlich mal ’ne Straße im Tal bauen?“ fluchte der Konde jedesmal, wenn er seine Pferde die Holzhauser Steige hochtrieb. Hinter ihm ritt der Held und schaute düster. Die Sache musste doch auffliegen! Links und rechts keuchten die Schramberger. Von oben „stürmte“ es, alle Glocken zugleich, aber kein Mensch ließ sich blicken. Nach Mühlheim zu senkte sich die Straße, die Freischärler fielen in Tritt und sangen wieder: „Fürsten, zum Land hinaus, jetzt kommt der Völkerschmaus.“ „Gib schon auf!“, hörte der Jegglin die Stimme seiner Frau. „Sieh dir diese Truppe an. Die verscheuchen keine Judenschule! Und ihr kriegt es mit Soldaten zu tun, echten.“ Judenschule! Warum seine Frau Juden so hasste, war dem Jegglin ein Rätsel. Und er fand es furchtbar, wie man denen im Odenwald mitgespielt hatte. Wenn das hier schiefgeht, wer wird dann wohl der Sündenbock sein? Egal, wenn sie uns nicht gleich erschießen, kommen wir eh auf den Demokratenbuckel. Ich könnt‘ ja versuchen, nach Tennenbronn rüberzumachen. Zur Base Antonie. Im Badischen wär‘ ich erst mal sicher. Aber Antonie, da wär‘ die Frau auch dagegen. Da läuteten die Mühlheimer Glocken Sturm.
Niemand auf der Straße! Die Sonne brannte aus einem blauen Himmel. Vermutlich würden sich wieder welche verdrücken. Wenn das so weiter ging, würden sie zehn Mann hoch in Stuttgart ankommen.
Der Jegglin hatte genug. Wenn die Bauern nicht mitmachten, hatten er und seine Leute hier nix verloren. Auf dem Winkelfeld rief er zu Rast und Ratschlag. „Der Held und der Moser und die, die sind schon weiter, nach Empfingen,“ wusste einer. Wie Jegglin es schaffte, diese Truppe einzuholen, zu entwaffnen und nach Mühlheim zurückzuführen, erfuhr der Konde nie. Wohl aber wurde er Zeuge, wie der zurückgekehrte Held ganz außer sich vor Wut geriet: „Umkehren? Wo wir so weit gekommen sind?“ „Das hat der Napoleon nach Smolensk auch gesagt“, wagte sich einer aus der Deckung, „und ist in die Falle getappt!“ „Ihr Feiglinge, davonlaufen wie die alten Weiber? Ein Hundsfott, sag‘ ich, wer jetzt aufgibt!“ Die tapferen Bürgerwehrmänner schauten betreten auf ihre Stiefelspitzen. Ja, die sang- und klanglose Heimkehr würde sie schon wieder, wie beim „Franzosenlärm“, einem Riesengelächter preisgeben. „Schlagt ihn vom Pferd!“, der Sauer Anton war, wie immer, schon um zwei Uhr mittags voll. Der Aufruf blieb unbeachtet. Denn hatte der Jegglin nicht Recht? Struve geschlagen, die Rottweiler auf dem Rückzug, die Bauern abwartend. Was konnten sie allein noch ausrichten? Da schlug die große Stunde des Reallehrers Lang. „Bürger“, schrie er, „Bürger, überlegt euch genau, was zuhause passieren wird: sie werden euch verhaften, vor Gericht stellen, sie werden uns Offiziere erschießen. Wir können nicht alle über die Grenze gehen, wer soll unsere Familien…“. „Du hast doch gar keine!“, rief der Sauer. Großes Gelächter. Der Lang wartete einfach, bis es wieder ruhig wurde. „Aber ich hab‘ Charakter. Und keine Verwandten in Tennenbronn!“ Der Jegglin wurde fuchsteufelswild. „Herrgottsapperment, wer hat gesagt, dass ich mich drücken will? Aber wenn wir weitermarschieren, dann ohne Waffen!“
Da brachen sie auch schon massenhaft auf, Held vornedran, neben ihm der Fahnenträger. Ihre Waffen warfen sie dem Konde auf den Wagen, die Trommeln dazu. „Fahr‘ zurück!“, sagte der Jegglin, „stell‘ den Wagen bei dir unter, wir holen die Sachen ab.“ „Und mein Fuhrlohn?“, fragte der Schäller. „Wenn wir zurückkommen, versprochen!“
„Das glaub‘ ich jetzt nicht!“, sagte der hohenzollerische Unteroffizier zum Posten an der Empfinger Steige. „Da kommen die zum dritten Mal. Und wir können wieder nix machen. Zieh die Schranke hoch! Aber nicht wieder salutieren, Kerl!“
„Hier, dein Gulden“, sagte der Apotheker Bauernfeind zum Polizeidiener Moser drei Stunden später. „Das hätt‘ ich wirklich nicht geglaubt, dass sie nicht mal bis Horb kommen. Und der Jegglin soll fast ganz allein nach Stuttgart gefahren sein.“ „Auf der Horber Steige haben sie wieder umgedreht. ’s ist halt nie zu spät, schlau zu werden. Und was will dein Jegglin in Stuttgart machen?“ „In Cannstatt ist Volksfest.“ Sie grinsten. Politische Gegner, die sie waren, wohnten sie doch in derselben Straße. Jetzt standen sie vor Bauernfeinds Apotheke und sahen zu, wie sich der Marktplatz schon wieder füllte. Von Holzhausen kamen die Freischärler in zerzausten Gruppen und stießen zu der Volksversammlung, zu der sich Gottlieb Rau vom Balkon des Rathauses ereiferte: „Der Satan kämpft durch seine Werkzeuge, die Beamten, gegen das Volk. Wollt ihr euch das gefallen lassen?“ Die Bürger unter ihm wollten es offenbar. Rau wirkte müde und ausgelaugt. Der Mühlhäuser neben ihm war auch nicht begeistert. Oberamtmann Herbort hinterm Fenster registrierte es wohl. An eine Festnahme war dennoch nicht zu denken. „Seid ihr denn nicht der Knechtschaft müde?“ Das Volk blieb stumm.
6. Sancta justitia
Donnerstag, 27. und Freitag, 28. September 1848, Sulz, Stuttgart
Wie sieht das jetzt aus?, dachte der Schäller, als er den Wagen mit den Waffen der Freischärler auftragsgemäß in seiner Scheune abgestellt hatte. Er war ja mitten durch die Stadt gefahren. Noch bevor er den Gedanken weiterspinnen konnte, tauchte jedoch auf dem Heuboden der Blondschopf seines „Bankerts“ Benefiz auf, für den Kondes unerwartete Heimkehr einige Schwierigkeiten aufwarf, hatten doch Alexa und er die Abwesenheit des Vaters zu zwischenmenschlichen Übungen benutzt, die bislang geheim gehalten und, überhaupt bei Unverheirateten, gesellschaftlich verpönt waren. Nun gehörte der Konde zwar nicht zur „Gesellschaft“, aber wie würde er reagieren? Gelassen, wie sich herausstellte. „Kinder, Kinder“, sagte er bloß, „wovon wollt ihr leben, wenn ihr erst verheiratet seid?“
In dieser Nacht schlief er dennoch tief und fest, zum letzten Mal. Am frühen Morgen verließ Gottlieb Rau die Stadt in Richtung Oberndorf. Der Oberamtmann Herbort erfuhr es als erster; vom Kronenwirt, dessen Gesuch um Namensänderung seines Gasthofes er noch am Tag zuvor abgelehnt hatte. „Was soll das, warum wollt ihr eure Schänke in ‚Corona‘ umbenennen?“, hatte er gefragt. „Wollt ihr vornehm werden? Quod licet jovi? Schenkt lieber besseres Bier aus!“ Der Kronenwirt wünschte sich in der Tat mehr solche Gäste wie den Glasfabrikanten Rau. Aber jetzt war der weg, und Herbort wusste, was zu tun war. „Als erstes den Mühlhäuser!“, schaffte er den Moser an. „Das kannst du allein. Dann gehen wir zum Schäller. Der hat sich eine ganze Ladung Waffen unter den Nagel gerissen. Sind die Zellen in der Torstraße gerichtet?“
Über alle Straßen des Königreichs Württemberg jagten berittene Boten. Steckbriefe, Verhaftungsbefehle, diplomatische Korrespondenz. Metternich, Herr aller Spitzel im Deutschen Bund, war geflohen, aber seine Geheimpolizei las immer noch alles Gedruckte und Geschriebene. Das vermutete auch der Reallehrer Lang, der soeben in der Scheuer des Bauern Kuhring aufwachte. Ihn würden sie zuerst suchen. „Häng daun jur hed, tom duli“, hatte er auf dem Rückzug vor sich hingesungen, in stetig wachsender Angst vor der Exekution. „Pur boi, jur baund tu dai.“ Hatten die hessischen Truppen nicht Heckers Freischärler einfach erschossen? Überhaupt, der Hecker! Der schwamm gerade auf der „Hermann“ auf dem Atlantik, frei und sicher. Wo aber sollte der Lang heute Nacht schlafen?
„Michael, ich brauche einen zuverlässigen Untersuchungsrichter und einen Richter für den Oberen Neckar!“ Justizminister Römers Anweisungen waren immer knapp und klar, und, bei näherem Hinsehen, angesichts der unsicheren Zeiten, eben doch eher geniale Absicherung nach allen Seiten. Was heißt schon „zuverlässig?“, dachte der Justizassessor German Michael. Sein Chef gab sich zwar gerne als Liberaler, aber Rau und Konsorten waren ja auch gegen seine Regierung aufgestanden. Am besten also einen harten Hund für die Untersuchung und einen vom Typ „väterlich“ als Richter. Zusammen mit dem Kommissär Kern vom Hohenasperg eine geradezu göttliche Dreifaltigkeit. „Mühlhäuser!“, rief er, „Mühlhäuser, jetzt geht’s Ihrem Herrn Vetter an den Kragen. Wie finden Sie das?“ Der Sekretär Mühlhäuser musste in diesem Ministerium Spötter und Neider nahezu jeden Tag darauf hinweisen, dass er jede Art von Verkehr mit seinem revolutionären Cousin, dem schwarzen Schaf der Familie, seit Jahren unterlassen hatte. Dass Michael ihm nun einen Brief an den Gerichtsaktuar Malzahn in Künzelsau diktierte, in welchem er den Malzahn zum Untersuchungsrichter am Oberen Neckar bestimmte, missfiel ihm dennoch. Blut war schließlich dicker als Wasser. Schon erleichterter stimmte ihn, dass der Schwurgerichtshof in Rottweil unter dem Vorsitz des Obertribunalrats Freiherr von Wächter zusammentreten sollte. Jetzt kam alles auf die zwölf Geschworenen an.
7. Wer sich in Gefahr begibt
Donnerstag, 9. November 1848, Hohenasperg, Sulz, Brigittenau (Wien). 43 Tage!
Der Konde konnte es immer noch nicht fassen. 43 Tage, und noch nicht ein einziges Mal verhört! Dabei musste doch jedes Verhör seine Unschuld beweisen. Sollte er sich geschmeichelt fühlen, dass man ihn auf dem Demokratenbuckel eingekerkert hatte? Der war ja nur für bessere Leute vorgesehen. Gottlieb Rau saß hier ein, der Mühlhäuser und die „Offiziere“ vom September, Jegglin und Lang, dazu viele Mit- Marschierer, und das hätte ein Trost sein können, aber sie durften nicht einmal miteinander reden. Dabei hätte die Prominenz so viel zu erzählen gehabt: Wie der Rau den Landjäger in Oberndorf schier anflehen musste, ihn zu verhaften. Wie der Jegglin sich auf eigene Kosten in einer Mietchaise von Schramberg zum Hohenasperg fahren ließ, während andere zum Haftantritt zu Fuß gingen. Wie manche gefragt wurden, ob sie eine Einzelzelle wollten oder lieber Gesellschaft. Wie man sich auf eigene Kosten Schweinebraten und Bier beschaffte. Welch schwunghaften Handel die Wärter trieben mit Schreibzeug und Kautabak. Der Konde konnte nicht schreiben, und der Braten war ihm zu teuer.
Was die Wärter nicht verhindern konnten oder wollten, war, dass die ganze Zellenzeile in Anfällen von Galgenhumor gelegentlich sang, am liebsten selbstironische Gassenhauer: „Ja, ich bin klug und weise und mich betrügt man nicht“, wobei sie die Texte gerne bis zur Kenntlichkeit veränderten. „Wir stecken in der…“. Was reimte sich nochmal auf „weise“? Der Rau, vornehm, wie er war, sang sowas natürlich nie mit. Auch der „schlafende Posten am Strande der Donau“ war nicht seins. Dann schon eher, wenn sie „Kein schöner Land in dieser Zeit“ quälten. Was sollte man auch von diesen verrückten Anklagen halten?! Der Sulzer Oberamtmann hatte beispielsweise den Konde allen Ernstes nicht nur der Teilnahme am Aufstand beschuldigt, des Hochverrats, darunter tat er’s nicht, nein, jetzt sollte er auch noch die Waffen seiner Genossen gestohlen haben, um sie zu versilbern. „Zeigen Sie mir doch irgendetwas Schriftliches von Herrn Jegglin, eine Rechnung, einen Fuhrauftrag, irgendwas!“ Und hatte ihn gleich wegen besonderer Gefährlichkeit hierher verlegen lassen. Na ja, der Bene hatte dem Herbort eine Tracht Prügel angedroht. Das war natürlich dumm und half keinem, aber der Konde war dennoch stolz auf ihn. Eine Weile jedenfalls. Aber 43 Tage! Wann würde der Kommissär Kern ihn endlich dem Jegglin gegenüberstellen? Denn, dass der ihn verleugnen würde, glaubte der Konde nicht.
Mittlerweile kämpfte in Sulz der Benefiz, der als einziger dafür in Frage kam, mit dem Rathaus um die Erlaubnis, den väterlichen Fuhrbetrieb „im Interim“ selbständig zu führen. Von den Geschwistern seiner Mutter lebten nur noch zwei: Andreas war nach Amerika ausgewandert, Edeltrudis hatte in der Schweiz den Schleier genommen, war jetzt Schwester Oberin. Die vier überlebenden Halbschwestern waren allesamt auswärts verheiratet. Der Aktuar Mayer wollte ihm deshalb einen Vormund aufs Auge drücken, schließlich war der Bene erst 24, also gar kein richtiger Gemeindebürger, und, zu allem Überfluss, hatte Vater Schäller sich seit Jahren um die Zahlung der gemeindlichen Wohnsteuer mit dem Holzkopf Mayer gestritten. Mit dem Vater im Zuchthaus, blieben manche Fuhraufträge aus, obwohl der Bene genauso tüchtig und fleißig war wie der Alte, das gaben alle zu. Aber „Mit Mann und Ross und Wagen hat sie der Herr geschlagen“, sowas haftete. Im November wusste der Bene nicht, woher er das Geld nehmen sollte, um seine Braunen zu füttern. Ja, Pferde, die fraßen den sauteuren Hafer auch, wenn sie nur im Stall standen; waren eigentlich Luxus. Sollte er auf Ochsen umsteigen? Die Konkurrenz würde sich ins Fäustchen lachen. Hatte denn die Alexa so gar nix beiseitegelegt? Nicht nur das, sie hatte auch eine weitere Neuigkeit parat, die sich mit dem Heu und der Scheuer erklärte. Auch das noch!
„Gott und gute Menschen werden Euch ja helfen. Leb wohl, theures Weib! Betrachte unsere Kinder als theures Vermächtnis, mit dem Du wuchern musst, und ehre so Deinen treuen Gatten. Tausend, tausend, die letzten Küsse von Deinem Robert. Die Ringe habe ich vergessen; ich drücke Dir den letzten Kuss auf den Trauring. Mein Siegelring ist für Hans, die Uhr für Richard, der Diamantknopf für Ida, die Kette für Alfred als Andenken. Man kommt! Lebe wohl! Wohl!“ Der das am frühen Morgen des 9. November schrieb und alsbald in der Wiener Brigittenau auf Betreiben der Regierung Schwarzenberg jedem geltenden Recht zum Hohn erschossen wurde, war Robert Blum, einer der besten Köpfe der Revolution, die vielen damit gescheitert schien. „Die mörderische Kugel“, sagte Pfarrer Sprißler auf der Totenfeier für den bis dato prominentesten Märtyrer der Revolution am 27. November, „ist durch alle Herzen gefahren“. Wieder standen sie zu Hunderten auf dem Sulzer Marktplatz, nahmen zur Kenntnis, dass ein katholischer Geistlicher Blum als Erlöser der Menschheit mit Jesus Christus gleichsetzte. Und begruben die Revolution in ihren Herzen. Vier Monate lang. Dann war wieder Ostern.
8. Die obligateste Ruhe und Stille
Frühjahr 1849, Sulz.
Die Grabesstille in Sulz zerrissen an einem Samstag im März zwei Schreie. Der erste kam von dem strammen Jungen, den Alexa ganz allein zur Welt gebracht hatte; der zweite, einige Stunden später, von Benefiz, der fassungslos vor ihrer Leiche kniete. Der Konde konnte ihn nicht trösten. Er stand daneben, nur noch Haut und Knochen. Im Januar hatten sie ihn endlich verhört, dann, nach der Aussage des Jegglin, entlassen. Sein Fuhrgeschäft hatte Konkurs angemeldet, die Schällers und Alexa waren in einer elenden Hütte unter dem Gähnenden Stein untergebracht worden. Am Abend von Alexas Armenbegräbnis ging der Bene in den Wald und hing sich auf. Der Konde lebte weiter. Es gab halt Einiges zu regeln, erst die Amme, dann die Bestattung, schließlich die Adoption. Die Eheleute Binder aus Bickelsberg, Oberamt Sulz, kinderlos, bigott, suchten einen Jungen zur Übernahme ihrer Bäckerei und ihrer Pflege im Alter. Unter der Bedingung, dass „Jasper Gerrit Binder“ niemals erfuhr, wer er war.
Nachdem also alles seine Ordnung hatte, war es reiner Zufall, dass der Schäller sich nicht zu Bene und Alexa gesellte. Allerdings sah er im hohen Alter mit wachsender Überzeugung das Walten einer höheren Macht darin, dass er, nachdem er seine Bude aufgeräumt, abgeschlossen und den Schlüssel in die Dachrinne gelegt hatte, auf dem kurzen Weg in den Neckar der Witwe Bollinger begegnete, die, in Kenntnis seiner Situation seine Absicht erratend, ihn erst ansprach, dann kurzerhand abschleppte. Seitdem ihr Schwager, der Schultheiß Fidel Bollinger von Oberndorf, sich vor Gericht wegen angeblichen Hochverrats verantworten musste, machte die Witwe aus ihrer Verachtung der herrschenden „Ordnung“ keinen Hehl mehr. Und leisten konnte sie es sich dreimal, war sie doch dank der Tüchtigkeit ihres verewigten Gemahls als Floßunternehmer die wohlhabendste Person im Ort. Dass der Pfarrer sie von der Kanzel, ohne Namensnennung, aber so, dass es jeder verstand, als Jezebel apostrophierte, ließ sie kalt, solange der Konde sie warmhielt.
Seit der Schäller und der Mühlhäuser am gleichen Tag den Hohenasperg verlassen hatten, waren sie Freunde geworden. Dabei war ihre Lage höchst unterschiedlich. Der Schäller war frei, der Mühlhäuser auf Kaution entlassen worden und wartete auf sein Hochverratsverfahren. Die 1000 Gulden hatte ihm Stadtschultheiß Pfäfflin vorgestreckt, aber ohne die Petitionen der „politischen Bürgergesellschaften“, die jetzt im ganzen Land wie Pilze aus dem Boden sprossen, wäre er nie freigekommen. Der Schultes hatte den beiden sogar Stehplätze hinten auf den Postkutschen spendiert, sodass sie noch am gleichen Tag nach Sulz zurückkamen. Da der Konde nun bei der Witwe Bollinger wohnte, hockten sie regelmäßig in ihrer Küche und politisierten, misstrauisch beäugt vom Personal; die Köchin berichtete regelmäßig an den Landjäger. Die Bollinger war eine blitzgescheite Person, und sie war es, die die zündende Idee hatte, welche zwei Jahre später zum Freispruch des Mühlhäuser und seiner Mitangeklagten in ihrem großen Aufsehen erregenden Prozess vor dem Rottweiler Schwurgericht führte. Und das kam so: Wieder einmal ging es um die mitgeführten Waffen. In jedem Ort hatten die Schultheißen die Freischärler angeschafft, ihre Gewehre und Sensen zurückzulassen. „Was hat der Jegglin meinem Schwager damals erwidert?“, fragte die Witwe. „Mir hat er auf dem Marktplatz erzählt“, erinnerte sich der Mühlhäuser, „er hat gesagt, dass kein württembergisches Gesetz das Tragen von Waffen im freien Feld verbietet.“ „Nicht gut genug,“ murrte die Bollinger, „innerhalb des Ortsetters wart ihr ja auch. Wir brauchen was Besseres.“ „Wir wollten sie ja niederlegen, sobald wir vor Stuttgart standen.“ „War das nicht leichtsinnig?“, warf der Konde ein. „In diesen Zeiten?“ „Mensch, du bist genial,“ die Witwe schrie es geradezu, „natürlich, die Zeiten waren gefährlich, für alle – auch für den König! Lass denken! Ich hab’s, zum Schutz des Königs (!) seid ihr bewaffnet nach Stuttgart gezogen!“ „Und ich“, schrie der Mühlhäuser jetzt wirklich, „hab‘ nur für Ruhe in der Stadt gesorgt, schließlich wussten wir nicht, was dem Pöbel einfallen würde. Die neuen Scheiben im Oberamt waren noch nicht mal bezahlt.“ „Wo bleibt da die Logik?“ Der Konde guckte schräg, sein Einwurf hatte in eine ganz andere Richtung gezielt und der „Pöbel“ gefiel ihm nicht. „Du hast doch alle jungen Männer zum Ausmarsch zwangsverpflichtet.“ „Ja eben, so konnten sie keinen Unfug im Städtle anrichten.“ „Junge, Junge, wenn das mal …“. „Das geht gut“, sagte seine Frau und Meisterin, „überleg doch mal, was die für Geschworene kriegen werden. Die wollen doch nicht alle nach dem Prozess wegziehen. Ich schreib‘ gleich dem Fidel, dass sie in toto so plädieren sollen.“ Die Köchin hinter der Tür verwünschte zum wiederholten Mal den affektierten Sprachgebrauch der Herrschaft.
9. In Hornberg schießen sie wieder
Montag, 20. Januar 1851, Rottweil, Zur Kanne, 12 Uhr.
„Hör mal“, sagte der Obertribunalrat Freiherr von Wächter kauend zu seinem Freund, dem Staatsanwalt Ober-Justizassessor Beck, „ich hab‘ kein gutes Gefühl. Wenn das so weiter geht, können wir uns den ganzen Zirkus sparen.“ „Du meinst die Sache mit dem Kräutle? Da konnte ich doch gar nicht anders.“ Bei der Wahl der zwölf Geschworenen hatte sich plötzlich herausgestellt, dass der Schmied Leonhard Kräutle von Lauterbach „aus Neugierde“, wie er sagte, mindestens bis Oberndorf am Zug nach Stuttgart teilgenommen hatte. Worauf der Beck ihn ablehnte. „Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs“, erklärte der Freiherr, „ich denke, die sind alle befangen. Hast du gesehen, wie der Schoder gegrinst hat?“ Der Rechtsconsulent Schoder war einer der beiden Verteidiger der insgesamt acht Angeklagten. „Die Geschworenen müssten halt auch von weither kommen, tun sie aber nicht.“
Zwei Tische weiter saßen der Schoder und sein Kollege Lutz über Maultaschen und Kartoffelsalat. „Was für ein Glück, dass die Geschworenen alle von hier sind“, sagte der Schoder mit vollem Mund. „Und die Idee, den Kräutle ‚auffliegen‘ zu lassen, großartig! Wieviel Demokraten sind jetzt noch unter denen, die zu wählen sind?“ „Lisette, noch ein Gläschen Bier!“, sagte der Lutz zum Servierfräulein. „Leise! Noch zwei zu wählen, aus sieben Kandidaten. Mindestens drei.“
Im Séparée der Kanne ließ die Witwe Bollinger auffahren. Der Konde, der schon wieder recht stattlich aussah, griff ebenso herzhaft zu. „Hast du gehört, was der Staatsanwalt von einer roten Fahne gefaselt hat? Ich frag‘ mich schon lange, was du neulich nachts so heimlich auf den Boden geschafft hast. Sah für mich aus wie ein langes, schmales Paket.“ „Hat mir die Schwiegermutter vom Uexküll gegeben,“ grinste der Konde. „War ihr zu heiß.“ „Der wartet ja immer noch auf seinen Prozess. Der und der Bauernfeind. Für den Bauernfeind seh‘ ich schwarz. Der ist zu grad raus. Den Uexküll kann ich gar nicht einschätzen. Was hältst du eigentlich von dem?“
10. Verschiedene Verlustmeldungen
Montag, 31. Januar 1848, Sulz, Mühlheim, Hopfau.
„Kann er nicht grüßen, Saulackel? Oder soll ich ihm den Hut erst vom Kopf schlagen?“ Der Oberförster Graf Kuno von Uexküll-Gyllenband war selten zimperlich in seiner Wortwahl, wenn er erst mal so richtig in Rage war. Und immer noch hasste er die ganze Welt, hasste alle Menschen, die nicht, wie er, unglücklich waren, hasste diese Waldarbeiter, die die Mütze nicht zogen, als er vorbeiritt. Eigentlich war es eine Mischung aus Wut und Trauer, war ihm doch vor neun Monaten die Frau gestorben, die ihn mit vier kleinen Kindern zurückließ im obersten Stock des Oberamtsgebäudes, der ihm nun dennoch so leer vorkam. Wut auf die Waldfrevler, die aus purer Not, das wusste er schon, stahlen und wilderten, was das Zeug hielt. Wut auf den Schultes von Bergfelden, der seine Holzdiebe auch noch in Schutz nahm. Wut auf die Finanz-Condottiere und innovationsgeilen Fabrikanten, die sich mit ihren neumodischen Dampfmaschinen regelmäßig verspekulierten und nur eine einzige Reaktion auf ihre Gier und ihr Marktversagen kannten: Massenentlassungen. Wut auf die Entlassenen, die in Scharen durch das Land zogen, bettelnd und klauend. Wut auf die Polizei, die der Plage nicht Herr wurde. Wut auf die Engländer, die den kontinentalen Markt mit billigen Textilien förmlich zuschütteten. Wut auf den Oberamtmann Herbort, der sich hasenmäßig in die Furche duckte, auf die Liberalen und Linken, die mit ihren Forderungen nach Einigkeit und Recht und Freiheit und was sonst noch die Spannung im ganzen Deutschen Bund bis zur Unerträglichkeit erhöhten. Hatte nicht gerade der Gemeinderat in Schramberg (!) darüber beraten, wie ein Übergreifen der Unruhen aus Sulz (!) zu verhindern sei? Ein Gemeinwesen, davon war der Oberförster überzeugt, brauchte Regeln. Damit sich jeder daranhielt, brauchte es Strafen und eine Macht, die sie durchsetzte. Zu den Regeln gehörte mehr, als den Hut vor besseren Leuten zu ziehen. Respekt musste man haben vorm Eigentum und vor der Unversehrtheit der Mitmenschen und eine begründete Hoffnung auf Hilfe in Notlagen. Von daher seine Wut, das wurde ihm jetzt klar, auf den Oberamtmann, denn der setzte keine Regeln durch, bot aber auch keine Hilfen an. Deshalb hatte er, Kuno, dessen Aufgabe das sicher nicht war, schließlich eine Bürgerwehr organisiert. Wenn schon Behörde und Polizei so versagten, musste man sich selbst helfen. Regeln, nicht Gesetze, dachte er und ertappte sich, wie er grinste: Wo kam denn derart subversives Gedankengut her? Aber da er nun schon mal im Fluss war: vorbildlich war sein Verhalten den Waldarbeitern gegenüber auch nicht gewesen. Heute Abend würde die Nachricht die Runde durch die Stammtische machen. Also gut: für den nächsten Tag nahm er sich fest vor, wenigstens seine Bürgerwehr besser zu behandeln.
„Jetzt haben sie in Empfingen auch schon eine Armenküche eingerichtet“, sagte der Mühlheimer Schultes Däuble in der außerordentlichen Gemeinderatssitzung, „wartet ab, gleich werden sie hier auch rumschreien.“ „Und in Schramberg und in Vöhringen“, ergänzte sein Stellvertreter, Schulmeister Cappus, der Vollständigkeit halber. Ja, ja, dachte der Däuble, und in Horb und auf Sumatra. Kein Mensch mag einen Rechthaber wie dich. „Ist ja auch kein Wunder, sonst sind im März die Saisonarbeiter und Gesellen in die Schweiz gegangen, aber jetzt sind sie alle noch da.“ Dies vom größten Bauern, dem Ludwig Schlotterbeck. „Ich sag’s ja schon lang, wir brauchen mehr Auswanderer!“ Der Däuble runzelte die Stirn; die bisherigen Wortmeldungen waren in der hierarchisch korrekten Reihenfolge abgegeben worden, aber nun drängte sich der Flickschuster Sauer vor. „Tausend Gulden für jeden, der geht!“ „Gehst du dann auch?“, erkundigte sich die Nummer vier in der Rangfolge, Jakob Ruoff, „dann bin ich dafür!“ Die beiden waren sich seit jeher spinnefeind. Verwandte, die sich um ein handtuchschmales Äckerle sogar vor Gericht stritten, obwohl der Sauer sonst nix zu beißen hatte und seine Kinder in Lumpen und barfuß gingen, Sommer wie Winter. Der Hölle und der Plocher Eduard schwiegen und guckten in die Luft. Das taten sie meistens, bis die Sitzung vorbei war. Aber das änderte sich, sobald sie den „König Friedrich“ betraten. Ziemlich hochtrabender Name übrigens für eine solche Bumskneipe. Sollte angeblich an den Besuch des neuernannten Königs Friedrich von Napoleons Gnaden erinnern, bei welcher Gelegenheit der „dicke Friedrich“ seine Kutsche beim Einsteigen zum Kippen brachte. Däuble, der 1816 noch in Russland gewesen war, bezweifelte ja, dass Friedrich I. je nach Mühlheim gekommen war, wie der Wirt behauptete, aber, egal, vielleicht nachts, vielleicht auf der Durchreise: Der Däuble fasste einen Entschluss. Gemeinderat Sauer hatte Recht, und er hatte es oft genug wiederholt, die Idee war nicht neu. Aber natürlich konnte sein Vorschlag nicht einfach übernommen werden, der Beschluss musste seinen, des Schultes, Stempel tragen. Er klopfte auf den Tisch. „Ich denke, die Idee ist gut. 500 Gulden für jede Familie, die nach Amerika auswandert. Keine Unterstützung für die Moldau, Bessarabien oder noch weiter östlich. Die kommen bloß alle wieder.“ Der Sauer stimmte als einziger dagegen. Wusste er womöglich, dass der Betreiber der Auswandereragentur in Sulz, Hermann Buttersack, ein Onkel von Däubles Frau war? Und Buttersack verkaufte nur Passagen nach USA.
„Um Gottes willen! Elisabeth!“ Zu Tode erschrocken, denn so hatte sie ihren Mann noch nie erlebt, eilte Frau Kammhuber die ausgetretene Treppe hinunter in den Kartoffelkeller. Sehen tat sie zuerst nichts, aber riechen konnte sie’s gleich. Auf der Kartoffelhorde, wo sonst allenfalls ein paar weiße Triebe ins Auge stachen, glitzerte im Schein der Kerze eine schwärzliche, nasse, zerlaufende Masse. Und stank gottserbärmlich. „Jetzt hat’s uns also auch erwischt.“ Die Kammhubers, Verwalter des Hopfauer Adelguts der Herren von Linden, hatten natürlich von der sich unaufhaltsam von Irland über ganz Europa ausbreitenden Kartoffelkrankheit gehört, nach Schramberg war sie ja auch schon vorgedrungen. Aber, weit abgelegen vom Dorf, hatten sie doch gehofft, verschont zu bleiben. Niemand wusste ja, wie sich die Seuche übertrug. Ob die Herrschaften am Ende sie verantwortlich machen würden?
11. Das war 'ne heiße Märzenzeit
Sonntag, 11. März 1848, Mühlheim, „Lamm“, 20 Uhr
„Weib, he, Anna, hol‘ mir die Lisa und die Heidrun! Und weck‘ den Gregor!“ Der dicke Lammwirt war am Rande des Herzkaschpers. Das halbe Dorf war in seiner Gaststube versammelt, und er kam mit dem Bedienen einfach nicht nach. Am liebsten hätte er sich einfach an den Stammtisch gesetzt, war er doch selbst ein leidenschaftlicher „Politisierer“. Aber zum Politisieren brauchte man Ruhe, um ein Argument zu entwickeln, brauchte notwendig einen kleinen Kreis von Zuhörern. Keine Massenversammlung, wo jeder jeden ansteckte mit seiner Hysterie. Frauen waren ja auch darunter. Und die verstanden nix, wussten aber alles. Übertroffen bloß von Figuren wie dem Aushilfslehrer Süß. „Jud Süß“ nannten sie ihn im Dorf, in schlimmer Anspielung an den „Geheimen Finanzrat“, mit dem es vor 100 Jahren ein schlimmes Ende genommen hatte. Nun war der Aushilfslehrer Süß aber bitterarm, wo der Jude ein Lebemann gewesen; war Katholik, wenn auch nicht praktizierend; hatte noch nie eine Kutsche von innen gesehen, noch nie eine Frau geküsst, wo der Finanzrat am Hofe Alexanders… Aber auch dafür war er gehängt worden. Die einzige, wenn auch zutreffende Übereinstimmung ergab sich aus beider vertieftem Verständnis vom Wesen des Geldes, was beim Lehrer allerdings nur theoretischer Natur war, entstanden aus dem Abonnement der „Frankfurter Fliegenden Finanzblätter“. Wenn er den Stammtisch von der Notwendigkeit zu überzeugen versuchte, die unterkapitalisierten Zollvereins- Banken in Aktiengesellschaften zu verwandeln, um den Engländern standzuhalten, verdrehten die Mühlheimer Honoratioren die Augen. Auch jetzt führte er das große Wort. „Wenn die Banken zusammenbrechen, bricht alles zusammen. Die Banken haben die Maschinenfabrik Keßler ruiniert, den Schwarzwälder Boten schon damals aus Sulz vertrieben und die Ansiedelung der Baumwollspinnerei verhindert. Weil sie vom Staat wie Kinder bevormundet werden.“
„Halt mal die Klappe“, sagte Schultes Däuble, „wir haben ganz andere Sorgen.“ Und dachte an die Tausenden von Bauern, die nur wenige Kilometer entfernt die Residenz in Hechingen gestürmt und den Fürsten zum Verzicht auf alle Abgaben „bewogen“ hatten. Selbst Ehebewilligungen waren jetzt abgeschafft, ging es ihm durch den Kopf, das verhieß nichts Gutes für die Gemeindekasse. Hatten ihm doch „seine“ Bauern rundweg erklärt, nicht einmal die Abgaben nach Sulz aufbringen zu können. Würde das Oberamt jetzt wieder „Presser“ schicken, die von Haus zu Haus zogen und Steuern eintrieben, mit 40 Kreuzern Zuschlag? Was gäbe das erst für ein Geschrei! Und dann kämen wieder die Husaren! Man musste diesen Aufruhr überall in vernünftige Bahnen lenken! Jetzt schwenkten sie alle schwarzrotgoldene Fahnen, aber wer erinnerte sich denn noch an die Versprechen von 1814: statt 39 Staaten ein einiges Deutschland, Verfassung, Freiheit. Und wer wusste, was das bedeuten würde? Den Däuble schauderte bei dem Gedanken, mit Hessen, Kölnern und Preußen gar in einem gemeinsamen Staat zu leben. Nein, die Mühlheimer würden eine ordentliche Petition an die revolutionäre Regierung in Stuttgart verfassen, dafür würde er sorgen. Und dann wäre erst mal … „Ruhe!“, donnerte er jetzt, „Ruhe! Wenn einer eine Beschwerde hat, dann soll er sie gleich vortragen, hier, unser Herr Süß schreibt alles auf, und das schicken wir dann nach Stuttgart.“ Da ging es erst recht los. „Süß, schreib‘!“, sagte der Däuble und holte aus dem Geschrei heraus, was ihm sinnvoll schien: „Gerechte Steuern, Verhinderung der vielen Schreiberei, Abschaffung aller Abgaben und Vorrechte, Abschaffung der Brandmauern zwischen Haus und Scheuern.“ „Allgemeine Gewerbefreiheit“, schrieb der Süß dazwischen. „Verminderung der Beamtenpensionen! Nein, Pressefreiheit bedeutet nicht Freiheit von „Pressern“, das ist für die Zeitung. Mehr Macht der Schultheißen gegen Verschwender, Diebe, Arbeitsscheue und Gesindel. Unterschrift: Ehrerbietigst. So, jetzt kommt her und unterschreibt.“
Einen Tag später, Sulz, 18 Uhr, Floßanlegestelle. „Kompanie, stillgestanden!“ So standen sie vor ihm, krummbeinig, dickbäuchig die meisten, einige auch stramm, soldatisch. „Gewehr über!“ Warum hab‘ ich mir das angetan? Aber ich wollte ja freundlich werden. Am Anfang, dachte der Kommandant von Uexküll-Gyllenband, hatten sie ja noch auf dem Marktplatz exerziert. Aber das hatte zu viel Gelächter gegeben, weshalb sie jetzt hier unten im Matsch herumstolpern mussten. „Links um! Im Gleichschritt, marsch!“ Das war das heikelste Kommando. Den Passgänger war der Oberförster schließlich losgeworden, er war so groß, dass man ihn nicht ans Ende der Reihe stellen konnte, aber immer noch eine Gefahr war der Gerber Reinhardt, der links und rechts nicht auseinanderhalten konnte. Heute war er jedoch mal gut drauf und begnügte sich mit zwei Sabotagewendungen. „Bürger“, sagte ihr gewählter Kommandant beschwörend, „wenn wir erst unsere eigene Fahne haben, darf so etwas nicht passieren.“ „Wann wird das sein?“, fragte doch einer aus dem Glied, und der Oberförster musste sich mit Gewalt den Hinweis verkneifen, dass genau so etwas einfach unmöglich war. Demokratische Wehr! Ein Witz! Im Glied den Vorgesetzten anzusprechen! Aber das mit der Fahne, das wüsste er selbst gerne, hatte er doch nicht weniger als 60 Gulden dafür geopfert. Zwei Tage nach dem Vorfall im Wald.
12. 40.000 Mann französischen Gesindels
Freitag/ Samstag, 24./ 25. März 1848, Oberndorf, Sulz, Vöhringen, Balingen,
Rottweil, Zimmern, Flözlingen, Stetten.
„Soll ich das wirklich in die Zeitung setzen?“, Wilhelm Brandecker, Herausgeber und Redakteur des Schwarzwälder Boten kratzte sich mit dem Bleiguss der Zahl 4 am Kopf. „Was können 40.000 Franzosen in Württemberg wollen? Kartoffeln verkaufen?“ Er lachte bitter. „Was meinst du, Amelie?“ Seine Frau starrte auf die am Setzkasten liegenden Meldungen: „Das Oberamt Vaihingen fordert 3.000 Gewehre gegen die ’sengend und brennend eingebrochenen französischen Arbeiter‘. Rottweil meldet dem Oberamtmann Hörner in Tuttlingen 40.000 Mann französischen Gesindels. Wolfach soll schon brennen. Das ist alles so völlig daneben. Der Bote aus Haslach wusste von nix.“ Sie grübelte. „Fragen wir doch den Moser!“ Den Kaufmann Johannes Moser, offiziellen Gesandten der Stadt Straßburg, die sich in der Revolution ganz auf die Seite der Republikaner geschlagen hatte. Jetzt bereiste er das obere Neckargäu und versicherte allen Geschäftsleuten, dass sich am Handel mit Getreide, Obst, Salz und Wein nichts ändern müsse, egal, wer oder was in Paris regiere. Schultes Bollinger hatte ihn mit allen Ehren am Abend zuvor empfangen, der Brandecker war auch dabei gewesen. Der Moser trug, wie es sich für Revolutionäre ziemte, einen Rauschbart und legte seine Trikolorenschärpe wohl nicht mal im Bett ab. Und saufen tat er, dass die Haare rauchten. Im trüben Morgenlicht der Schankstube des Hotels Post sah er nicht mehr so geleckt aus. Aber er konnte den Redakteur Brandecker beruhigen. „Ich weiß, dass euer exilé, wie sagt man, euer Verbannter Herwegh, in Paris eine Legion zusammenstellt und über le rhin gehen will, aber das sind alles deutsche Flüchtlinge. Und er ist noch lange nicht so weit. Alles andere ist Quatsch.“
Kein verkaufsfördernder Bericht also. Die Erleuchtung, die dem Schwarzwälder Boten widerfuhr, blieb deshalb seinen Lesern und anderen Mitbürgern vorenthalten. Weshalb überall im Oberamt Sulz Geld und Schmuck vergraben, die Sturmglocken geläutet und Waffen an Freiwillige ausgegeben wurden. Die Mühlheimer waren sich ganz sicher, dass die Franzosen „vom Kniebis her kämen“ und Däuble verschanzte seine Gardetruppen unterhalb der Unteren Mühle, nach einem Plan von Schulmeister Cappus, der seinen Vauban studiert hatte und also einen Wall forderte, aber nur einen Schützengraben bekam, einen ganz flachen. Auf diese Nachricht hin stellten die Vöhringer eine 68 Mann starke Streitmacht auf und marschierten dem Feind entgegen. In Rottweil rückten sie mit Mistgabeln aus, ebenso die Balinger. Am Samstag wählten die Flözlinger in großer Furcht einen Hauptmann und verbündeten sich mit den Truppen aus Stetten und Zimmern, alle konfessionellen Schranken niederreißend. Da kämpften die wackeren Streiter aus dem Mühlbachtal schon mit den Folgen der großen Besäufnisse, die überall da begonnen hatten, wo sich statt der Franzosen den Kriegern Wirtschaften in den Weg gestellt hatten.
Dem Apotheker Bauernfeind schien das im Nachhinein alles nicht lächerlich, sondern furchterregend. Wie groß musste die Spannung sein, dass so ein irres Gerücht solche Massen in Bewegung setzten konnte? Und wozu waren solche Massen fähig? An der Baustelle der Bahnstrecke Geislingen-Ulm fielen 200 einheimische Bauarbeiter über ihre italienischen Kollegen her und vertrieben sie; der Subunternehmer zog sich zurück. Im Odenwald und in Franken verletzten Bauern jüdische Mitbürger und plünderten sie aus, vernichteten Steuerakten und zogen mit Knütteln und Spießen gegen Adelssitze. Vor zwei Wochen hatten sie das auch in Hechingen getan. Seine Frau regte sich über diese Gewaltausbrüche furchtbar auf. Nicht gerade günstig für eine Schwangere! Bauernfeind hoffte auf einen weiteren Sohn. Und er hatte auch schon einen Namen für ihn: Gustav.
13. Herborts Erzählungen
Donnerstag, 27. April 1848, Sulz, Oberamt.
„An die Regierung des Schwarzwaldkreises“, schrieb Oberamtmann Herbort in seinem wöchentlichen Rapport, „der Aufstand des Rechtsanwalts Hecker im Badischen hat hier keinerlei Wirkung gezeigt. Erst die Petitionen und dann die Wahl zur Nationalversammlung haben die Gemüter offenbar beruhigt. Und die Feldarbeit, natürlich. Derzeit sind jedenfalls keine roten Fahnen zu sehen. Aber die Lage bleibt latent instabil. Hier in Sulz hat man, wie erwartet, den Stadtschultheißen Pfäfflin gewählt, einen verkappten Demokraten, aber Gottseidank hat nicht er den Wahlkreis gewonnen, sondern Professor Christian Frisch aus Stuttgart. Wie der sich entwickelt, bleibt abzuwarten. Radikale Überzeugungen jedenfalls, gewinnen hier immer mehr Zulauf, insbesondere aus den pauperen Classen. In Mühlheim bekam jeder Wähler gar 10 Kreuzer von der Gemeinde als „Wegzehrung“. Dass in Hohenzollern der umstürzlerisch gesinnte Pfarrer Sprißler gewählt wurde, muss jeden aufrechten Vaterlandsfreund beunruhigen. Dessen demagogische Reden könnten im Zuge der kommenden Landtagswahl leicht in Sulz einen Brand entfachen. Weshalb ich dringend darum bitte, nicht nur in Rottweil, sondern auch hier Truppen zu stationieren, am besten Husaren, die erzielen stets den besten Eindruck. Große Hoffnungen setze ich zwar auf unsere Bürgerwehr. Aber für die Bekämpfung eines größeren Aufruhrs ist sie nicht ausgerüstet.
Die Ursachen des ‚Franzosenlärms‘ sind jetzt geklärt. Eine Gruppe obdachloser Arbeiter hat in einer Wirtschaft in Breisach die Zeche geprellt und randaliert, woraufhin jemand die Sturmglocke geläutet hat, was zum Gerücht führte, die Franzosen seien über den Rhein nach Offenburg und Schiltach vorgedrungen.
Zur Aufklärung hat insbesondere ein hiesiger Fuhrunternehmer beigetragen. Ich behalte ihn im Auge, vielleicht kann er noch einmal nützlich sein.
Ehrerbietigst, Oberamtmann Herbort“.
Donnerstag, 28. September 1848, Sulz, Oberamt.
„An das Königliche Ministerium des Innern, die Mitteilung betreff des Unterlassens des Salutschießens der Bürgerwehr am gestrigen Geburtstag seiner Majestät des Königs. Dies entsprach einem Wunsche des Sulzer Gemeinderates, und zwar wegen der finanziellen Lage der Stadt, gleichwohl die Glocken zum Festgottesdienst läuteten.
Vom Haftbefehl gegen den Aufrührer Gottlieb Rau, der am Abend des 27. auf dem Marktplatz eine Rede hielt, habe ich erst am 28. des Monats erfahren und sofort Schritte in die Wege geleitet. Da war der Rau schon abgereist.
Ehrerbietigst, Herbort, Oberamtmann.“
Donnerstag, 30. November 1848, Sulz, Oberamt.
„An das Königliche Kriminalamt in Stuttgart, bezüglich der Anzeige des Skribenten Mühlhäuser, derzeit in Untersuchungshaft auf dem Hohenasperg, gegen mich, erlaube ich mir die Richtigstellung, dass ich in der Tat für meine Aufgabe gehalten habe, auf die Demokraten durch Belehrung und Warnung einzuwirken, wozu ich mich ins Wirtshaus zum Schnapstrinken begeben musste, denn zu mir kamen sie nicht. Der Verkehr war mir äußerst unangenehm, aber nur so konnte ich exemplum gratia Kenntnis vom Treiben des Vöhringer Volksvereins erhalten. Wie nötig das war, ergeht zwingend aus dem Vorfall letzten Sonntag, als am Portal des Oberamtsgebäudes das Bild des Königs vorgefunden wurde, den Kopf kreuzweise durchschnitten, die Brust durchlöchert. Der Übeltäter ist trotz einer in Aussicht gestellten Belohnung von 50 Gulden noch nicht ermittelt.
Einen Heckerhut besitze ich nicht, geschweige denn eine rote Mütze, wohl aber einen Bürgerwehrmannshut und eine aus verschiedenen Farben geflickte Hauskappe, deren Tragen aber nicht als eine politische Aussage betrachtet werden kann.
Zutiefst ehrerbietig, Herbort, Oberamtmann“.
14. Auf der Kippe
Montag, 22. Januar 1849, Sulz, Vorstadt.
„Siebzehn Gulden für beide“, sagte der Maylinger zum Bene und betrachtete mit schlecht verhohlenem Gefallen die beiden Braunen, „mein letztes Wort. Heruntergekommen, wie die sind.“ Abzüglich unserer Schulden bleiben uns dann drei Gulden zum Leben, dachte sein Gegenüber, wie soll das gehen? Und schlug ein.
Friedrich Wilhelm Maylinger, Fuhrunternehmer, hatte sich im Laufe des vergangenen Jahres erstaunlich lern- und anpassungsfähig gezeigt, hatte er sich doch vom Monarchisten zum Petitionär zum Republikaner zum Demokraten zum Verfassungsfreund entwickelt. Zurzeit war er allerdings, vorsichtig geworden, hauptsächlich Geschäftsmann. Eine kühle Analyse der Lage hatte ihn zu der Überzeugung gebracht, dass dem Land turbulente Zeiten bevorstünden. Denn einerseits galten in Württemberg seit einer knappen Woche die in Frankfurt von der Nationalversammlung verabschiedeten Grundrechte, andererseits waren die Monarchen ringsum erfolgreich dabei, die Revolution zurückzudrängen, ja auszutreten. Und „turbulente Zeiten“ waren gleichbedeutend mit Volksversammlungen, Demonstrationen und Truppenbewegungen, also mit vollem Auftragsbuch, wenn einer auf dem Quivive war. „Brauchst du deinen Leiterwagen noch?“, warf er im Abgehen noch hin. „Ich wäre interessiert.“
In der Stalltür stieß er beinahe mit dem Oberförster von Uexküll-Gyllenband zusammen. „Bene“, rief dieser, „gute Post! Dein Vater kommt bald frei; ich hab’s aus sicherer Quelle.“ Der Bene brachte keinen Ton heraus, erst als der Uexküll fortfuhr: „Und ich brauche Wagen und Kutsche von dir in zwei Wochen nach Betra“, schüttelte er langsam den Kopf. „Wir haben jetzt unseren eigenen März-Verein und wollen auch auf die Dörfer hinaus.“ „Zu spät, ihr kommt zu spät“, platzte es aus dem Bene heraus, „habt ihr nicht gesehen? Grad‘ hab‘ ich die Rösser verkauft. Verkaufen müssen.“
Im Schein der Unschlittkerze saß, drei Häuser weiter in seiner ungeheizten Dachstube, der Collaborator der Lateinschule, Justus Bernhard, und brütete, in seinen Mantel gehüllt, über dem Schreiben seines Präzeptors. War das schon die Kündigung? Oder doch nur ein Schuss vor den Bug? „Es ist mir zu Ohren gekommen, dass er im Fach Geographie in seiner Unterklassenabteilung den letztjährigen Konflikt um Schleswig-Holstein und den Frieden von Malmö behandelt haben soll, wobei einige Schüler angeblich Kritik am Reichsverweser, seiner Königlichen Hoheit Erzherzog Johann, geübt haben sollen. Es versteht sich von selbst, dass unreife Knaben mit einer Beurteilung dieses vielschichtigen Komplexes überfordert sind und also erst gar nicht dazu ermutigt werden sollten. Das trifft meines Erachtens auch auf ihn selbst zu, mit seiner Zuckerbäckerausbildung! Weitere Schritte vorbehalten.“ Ja, dachte der Bernhard grimmig, immer schön vorbehalten. Man weiß ja selbst als Präzeptor nicht, was kommt. Wer gewinnt. Die Revolution steht auf der Kippe. Noch sind wir nicht besiegt.
Seufzend wandte er sich dem Stapel Rechnungen zu, den er bis zum nächsten Morgen für den Aktuar Mayer kopieren musste. Von seiner Vergütung als Hilfslehrer konnte keine Kirchenmaus leben.
15. Wie Seife am Maibaum
Mittwoch, 30. Mai 1849, Sulz
Für ’nen Apotheker hat er einen erstaunlichen Hufeisenverschleiß, dachte der Schmied Johannes Schmid. Selbst der Uexküll kommt nur alle sechs Wochen. Aber mir soll’s recht sein. Und ich will auch gar nicht wissen, wo der überall hinreitet. Hatte doch neulich sogar der Oberamtmann im Plauderton solche Auskunft aus ihm herausholen wollen. Allen Sulzern war natürlich klar, dass der „bekannte Republikaner“ Bauernfeind nicht zu seinem Vergnügen und auch nicht aus geschäftlichen Gründen so oft unterwegs war. Seit der preußische König Friedrich Wilhelm IV. die ihm von der Nationalversammlung angebotene Krone als „Reif aus Dreck und Letten gebacken“ abgelehnt hatte, gärte es im Land. Überall sprossen die Volksvereine wie Pilze aus dem Boden, in Baden brach die Revolution zum dritten Mal aus, und schien sich dieses Mal behaupten zu wollen. Und Bauernfeind hatte eine Botschaft: Wir Württemberger müssen selbst die Revolution machen und nicht für uns machen lassen! Auf nach Stuttgart, stürzen wir die Regierung, verhaften wir ihre Handlanger! Anna Maria Bauernfeind war es himmelangst. Unter ihrer Schürze klopfte, sieben Monate nach Gustav, schon der nächste Sprössling an. „Du bringst uns noch alle an den Bettelstab! Und dich an den Galgen!“
Friedrich W. Mayerling saß über seiner Abrechnung. Seine Kalkulation war glänzend aufgegangen, zusätzlich zum Alltagsgeschäft schlugen am Sonntag die Transporte der Fahnen, Trommeln, Fußkranken zu Buche, alle Gespanne waren permanent eingesetzt. Dass die Leute ihn scheel ansahen, seit das Schicksal der Familie Schäller so übel mitgespielt hatte, konnte er verkraften. War ja nicht seine Schuld. Jetzt schrieb er am Rand einer Kopie der Abrechnung der Transporte nach Betra zur Märzvereinsversammlung am 11. Februar, dass dort der Oberförster von Uexküll-Gyllenband einerseits für die Republik, andererseits sehr bieder und anspruchslos aufgetreten war. Einen ihm als etwas rätselhaft in Erinnerung gebliebenen Satz zitierte er wörtlich: „Erlösung von Dummheit und Zwietracht bringt Freiheit.“ Diese Randnotiz war für das Oberamt bestimmt, wohin die Kopien aller Rechnungen neuerdings gingen.
Regelmäßig fuhren Volksversammlungsteilnehmer nach Haigerloch. Richtig fett verdient hatte er im März, als die Sulzer Bürgerwehr dem amtsenthobenen Empfinger Pfarrer Sprißler zusammen mit 5.000 Demonstranten den Rücken gegen seinen Bischof stärkte, und im April, als der Sulzer Märzverein sage und schreibe 7.000 Teilnehmer auf den schwarz-rot-gold-geschmückten Marktplatz brachte. „So viele Menschen hab‘ ich hier nicht mehr gesehen seit sie den Hannikel aufgehängt haben“, hatte Mayerling senior ehrfürchtig gesagt. Die Reutlinger Pfingstversammlung brach schließlich alle Rekorde. „Wie, Herr Schultheiß, 40 Wagen, 80 Rösser, wie soll ich die zusammenbringen?“, hatte er zwei Tage vorher den Pfäfflin gefragt, der ihn erst vorgeladen hatte, dann ewig lange warten ließ vor der Tür des Ratssaales. Da saßen sie alle zusammen, die Köpfe der Revolution: neben dem Schultes der Mühlhauser, natürlich, der Oberförster, sogar der Bauernfeind, der sonst eher vorsichtig war, dazu der Lindenwirt Scherer und der Oberndorfer Bollinger. „Wir machen das so“, erklärte der Mühlhäuser, „jedes Dorf muss eine bestimmte Anzahl Männer für den Marsch nach Reutlingen hierherschicken. Vöhringen zum Beispiel 50, dazu die nötigen Pferde und Wagen. Abmarsch Sonntagabend, 6 Uhr. Ihr transportiert 100 Männer aus Sulz, das werdet ihr wohl hinkriegen. Ihr wolltet uns ja nach Oberndorf zur Volksversammlung fahren. Und sorgt dafür, dass genug Hafer mitgeführt wird. Für alle! Wie lange brauchen wir bis Reutlingen?“ Der Mayerling überlegte nicht lange. 16 bis 17 Stunden angeben, dann stand er mit vielleicht tatsächlich 15 gut da. „Und der Fahrpreis? Ein Gulden, damit komme ich grad so hin.“ „Noi, sagte der Pfäfflin, „die Hälfte; wenn er deutlich mehr braucht, komm‘ er zu mir.“ Und damit war er entlassen. Im Hinausgehen hatte er den Lindenwirt noch sagen hören: „Haben wir dann noch Reiter und Pferde für die Staffetten? Und wer baut die Holzstöße auf?“
Holzstöße! Da hatte er gewusst, die planten mehr als nur eine Fahrt zur Volksversammlung, um den König zur Annahme der Reichsverfassung zu zwingen. Brennende Holzstöße auf den Höhen, das war das Zeichen für den Aufstand. Ja, klar: wenn der König ablehnt, greift Württemberg zu den Waffen.
Nur, dass die Reutlinger Versammlung das abgelehnt hatte. Eine Delegation hatte sie nach Ludwigsburg geschickt, der Bauernfeind gehörte auch dazu, aber dann hatte der König auf Zeit gespielt. Und heute Morgen waren die verbliebenen Mitglieder der Frankfurter Nationalversammlung in Stuttgart eingetroffen, wo sie sich sicher fühlten. Und sie, die Abgeordneten, stellten die einzige demokratisch legitimierte Körperschaft dar, und an ihr war es jetzt, über einen Aufstand zu entscheiden.
Das aber konnte dauern. Die Paulskirchenversammlung war berühmt dafür, dass sie nix gebacken kriegte. In der Zwischenzeit hatte der Maylinger seine Abrechnung über 1 Gulden pro Person eingereicht und als Fahrpreis 24 Kreuzer angegeben, auch wenn die meisten Mitfahrer ihm für 30 Stunden Rüttelei einen halben Gulden gezahlt hatten. 24 Kreuzer waren einerseits gut für den unwahrscheinlichen Fall des Sieges der Aufständischen, andererseits ging die Abschrift ja als Liste ans Oberamt. Zwei Tage danach. Mit 400 Namen.
Der Pfäfflin war allerdings ins Badische gereist, Aufstand gucken.
16. Nach dem Sturm
Montag, 25. Juni 1849, Sulz.
„Pack‘ mir bitte einen Notfallkoffer, jetzt kommen sie jeden Tag mich holen“, sagten so oder so ähnlich der Mühlhäuser und der Bauernfeind zu ihren Frauen, der Uexküll zu seiner Schwiegermutter. Nachdem der König das Stuttgarter „Rumpfparlament“ mit Gewalt auseinandergetrieben hatte und der Aufschrei ausblieb, hatten sie die verzweifeltsten Anstrengungen unternommen, den großen Schwüren Taten folgen zu lassen. Allein das leicht vorhersehbare Scheitern der badischen Revolution, die Niederschlagung des Dresdener Aufstands durch preußische Truppen und der Aufmarsch württembergischen Militärs vor Riedlingen durchkreuzten ihre hastig ausgearbeiteten Pläne. Die Bürger blieben zuhause, die Waffen wurden eingesammelt, die Holzstöße verkauft.
Drei Errungenschaften der Revolution blieben: In den kommenden Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung zeigte sich die überwältigend republikanisch-demokratische Einstellung vieler Sulzer. Geschworene und Verteidiger hielten es für ihre Pflicht, den Angeklagten in den Hochverratsverfahren beizustehen. Schultes Pfäfflin blieb im Amt.
Mittlerweile sah in Bickelsberg Jasper Gerrit Binder satt und sauber einer gesicherten Zukunft entgegen.
Fortsetzung folgt...

Autor:
Klaus Schätzle, geb. 1948
Lokalhistoriker mit ausgeprägter Schwäche für „Geschichte von unten“.
Kapitel 1: Revolution
Autor:

Klaus Schätzle, geb. 1948
Lokalhistoriker mit ausgeprägter Schwäche für „Geschichte von unten“.
 In Sulz kann das Buch in der „Blass Erlebniswelt im Backsteinbau GmbH“ und bei der „Buchlese“ am Marktplatz erworben werden.
Erschienen ist das Werk im Verrai Verlag / Stuttgart mit der
ISBN 13: 978-3-948342-72-2.
In Sulz kann das Buch in der „Blass Erlebniswelt im Backsteinbau GmbH“ und bei der „Buchlese“ am Marktplatz erworben werden.
Erschienen ist das Werk im Verrai Verlag / Stuttgart mit der
ISBN 13: 978-3-948342-72-2.